Alkohol ist keine Lösung. Das wissen zwar alle irgendwie. Aber er ist nach wie vor die Droge Nr. 1 in Deutschland. Er spielt eine ganz unerhörte gesellschaftliche Rolle. Denn er kommt meist dann zum Einsatz, wenn wir über die Dinge, die uns wirklich quälen, nicht reden wollen. Und das hat oft eine lange Vorgeschichte, wie Christine Koschmieder in ihrem sehr persönlichen Roman erzählt.
Auch wenn sie als Warnung vorwegschickt: „Dry ist meine Geschichte, aber es ist nicht unbedingt die Geschichte derer, die darin vorkommen.“ Man findet also die Geschichte der Autorin darin, die 1972 in Heidelberg geboren wurde und seit 1993 in Leipzig lebt. Und auch wenn die Menschen, die darin vorkommen, andere Namen bekommen haben, ist es ein sehr persönliches Buch geworden. Eines, dessen letzte Kapitel in einer Entzugsklinik bei Neuruppin handeln. Aber es ist kein König-Alkohol-Buch geworden. Auch wenn da und dort eine Menge Weinflaschen zur Tonne gebracht werden und mancher gesellige Abend mit ziemlich vielen Gläsern endet.
Denn in die Klinik hat sich die Heldin in Grunde selbst eingewiesen. Einweisen lassen, mit dem Gefühl, dass der Alkohol in ihrem Leben ein Problem sein könnte, aber dahinter etwas Anderes stecken muss. Etwas, was auch so viele Andere kennen, die mitten in einem tapfer durchgestandenen Leben eines Tages erschrecken – vielleicht wie die Heldin am Abendbrottisch mit den Kindern – dass sie sich genauso verhalten wie ihre Eltern. So, wie sie nie werden wollen.
Da haben sie sich ein Leben lang angestrengt, loszukommen und ihren Liebsten das niemals zumuten zu wollen. Und dann passiert es doch. Wahrscheinlich nicht zum ersten Mal. Man hat es nur vorher nicht gemerkt, weil man viel zu beschäftigt war mit dem Studium, der Arbeit, dem Leben, der Wohnung, dem Lieben, den Kindern und dem Tod.
Nur nicht aufgeben ….
Allein der frühe Tod ihres Mannes wäre genug Tragik für ein ganzes Leben. All die Hoffnungen, dass die Krankheit vielleicht doch in den Griff zu bekommen wäre, dass sie gemeinsam die Kinder aufwachsen sehen würden und das Leben ein gutes Ende nimmt – und dann das schwere Eingeständnis, dass das alles nicht in unserer Macht liegt. Und dass das Leben weitergeht, dass eine neue Wohnung gesucht werden muss, kleiner, bezahlbar, dass die Kinder weiter alle Liebe brauchen, dass frau sich nicht aufgeben darf.
Christine Koschmieder aber legt ihren Leser/-innen keine Lösung auf den Tisch. Bevor sie mit „Dry“ die Tage in der Klinik in Bilder packt, erzählt sie ihr Leben. Und zwar in zwei Teilen. Der erste liest sich ganz harmlos. Es ist ihr Leben in Leipzig, ihre Abnabelung von den Eltern, beide Lehrer, aber geschieden. Die Töchter blieben beim Vater, die Mutter brach den Kontakt fast völlig ab. Erst spät im Buch wird sie tatsächlich auftauchen als kleine, zierliche Person, der die Gesprächsaufnahme mit der längst erwachsenen Tochter gründlich misslingt. Nur ist diese Tochter nicht mehr abhängig von ihr, braucht ihre Liebe nicht. Braucht sie vielleicht doch. Aber sie weiß längst, dass sie die nie bekommt.
Und das – so erfährt man sehr spät – hat natürlich wieder Gründe in der Familiengeschichte der Mutter, einer von Snobismus und Dünkel geprägten Familiengeschichte reicher Leute, die es den angeheirateten Eisenbahner-Opa immer haben spüren lassen, dass er nicht genügt und nicht akzeptabel ist. Am Horizont wetterleuchtet der Zweite Weltkrieg, in den die drei Brüder der Oma gezogen waren – mit Doktortitel und SS-Mitgliedschaft. Koschmieder erzählt das fast wie beiläufig. Obwohl sie längst weiß, dass genau hier die Unfähigkeit begann, den nicht Standesgemäßen in der Familie gegenüber Verständnis, Nähe und Liebe entgegenbringen zu können.
Auch wenn sie ihre Oma anders kannte. Zumindest ein Stück weit. Dass ihr Oma den alten Dünkel selbst verinnerlicht hatte, wird ihr so nach und nach erst bewusst. Da helfen die Gänge auf den Dachboden, das Wühlen in alten Fotoalben der Mutter, die Suche nach dieser Mutter, die lieber ihre Familie verließ, als sich auf Nähe und Gefühle einzulassen.
Du sollst nicht merken …
Man kann das als ein Problem jenes dünkelhaften Bürgertums betrachten, das immer so stolz war auf seinen Reichtum, seine Titel und feschen Uniformen. Aber die Sprachlosigkeit hat ja nicht nur etwas mit Standesdünkel zu tun. Es ist auch die Sprachlosigkeit einer ganzen Generation, die ihr eigene Unfähigkeit, über Gefühle und Nähe zu sprechen, immer in Verachtung für die Jugend, die Underdogs, die „Linken“ sowieso verpackt hat.
Eine Verachtung, die ja nicht verschwunden ist. Es ist ja nicht nur die Nachkriegsgeneration, die es nicht fertiggebracht hat, die verschlossenen Gefühle frei zu lassen. Viele – viel zu viele Familien – haben das weitergegeben, dieses „Du sollst nicht merken“ im Sinn Alice Millers. Dieses stillschweigende Verbot, über die eigenen Gefühle zu sprechen oder sie gar zu zeigen. Dieses Verbot, Schwäche zu zeigen, geschweige denn Bedürftigkeit.
Darum geht es letztlich in dieser Geschichte, in der die Heldin vor allem eines gelernt hat: zu funktionieren, die Kontrolle zu behalten, keine Schwäche zu zeigen. So, wie das auch die Generation der Mütter schon vorgemacht hat, die stolze Generation der Wirtschaftswunder-Mütter, die sich immer mit den Idealen des fleißigen Mittelstands identifiziert haben – Küche, Häuschen, Auto, Karriere des Mannes. Es klingt nur ganz leise am Rande mit. Aber es steckt noch immer in diesem Land, in dem wir leben.
Und in dem all diese Fleißigen, Selbstkontrollierten und Anständigen nicht begreifen wollen und können, dass es ihr Lebensstil ist, der die Welt zerstört. Ihre Unfähigkeit, Ängste zuzulassen, Gefühle zu zeigen, oder gar Schwäche.
Leipziger Freiheit
All das, wovon sich die Heldin der Geschichte abnabeln wollte, als sie kurzerhand nach Leipzig ging und ein Leben in teilsanierten Altbauwohnungen begann, mit Kohleöfen und all den Improvisationen, die in Leipzig in den 1990er Jahren normal waren. Und was Vielen, die hier strandeten, ein Gefühl von Freiheit gab. Hier lernte sie die Liebe ihres Lebens kennen – später dann der tragische Tod des Geliebten.
Aus „Heller“ wurde „Dunkler“. Und dann eine „Grauzone“, in der das Leben weitergehen musste und „Elastikgirl aus der Puste“ kam. „Ich habe immer vermieden, mich den Gefühlen meiner Kinder auszusetzen. Habe mich entzogen und gute Gründe dafür gefunden“, lauten solche Sätze, in denen die Erzählerin im Grunde schon zurückschaut auf diese Zeit des besinnungslosen Funktionierens.
Da weiß sie schon, dass auch ihre Kinder darunter gelitten haben. Und so Mancher dürfte sich beim Lesen selbst erinnern an all die so fleißigen, funktionierenden Eltern in unserer verlogenen Leistungsgesellschaft, die sich „aufgeopfert“ haben, die „immer für dich da waren“, die nie ein eigenes Leben gelebt haben, weil sie glaubten, dafür sei kein Platz. „Weil ich das für das Leben gehalten habe“, sagte die Erzählerin an dieser Stelle zu ihrem inzwischen erwachsen gewordenen Sohn. „Weil ich nicht gemerkt habe, wie zerstörerisch das ist. Das war ja unser Leben.“
In der Klinik merkt sie dann, dass es gar nicht der Alkohol ist, der ihr Problem ausmacht. Sie ist immer kontrolliert. Sie ist bestens organisiert, hat immer eine Lösung und ist auf niemanden sonst angewiesen. Es ist ihr gar kein Problem, den Tag zu strukturieren und mit Sinn zu erfüllen. Nur ihre eigenen Gefühle lässt sie nicht zu.
Auf dem Trockenen
Und so wird dann der zweite Teil des Buches zur Spurensuche, tauchen wir mit ihr ein in ihre Kindheit und Jugend. Und erleben ihren Versuch, wieder Kontakt zu finden zu ihrer Mutter, nur um dann zu erfahren, dass die kleine Frau das überhaupt nicht zulassen kann. Berühren wird die Tochter diese so verschlossene und um ihre Souveränität besorgte Frau erst nach ihrem Tod.
Den Titel „Dry“ muss man also nicht unbedingt nur auf den Alkohol beziehen. Er hat auch etwas mit dem, „auf dem Trockenen sitzen“ zu tun, gestrandet sein, auf Grund zu laufen und zu merken, dass es so nicht weitergeht. Auch wenn am Ende nicht wirklich klar wird, ob der Klinikaufenthalt tatsächlich geholfen hat. Denn das Leben ist immer offen. Je mehr Antworten man findet, liest man, umso mehr Fragen tauchen auf.
Aber auch ein paar Erkenntnisse, die auch diese Heldin des ganz normalen verrückten Lebens so vorher nicht zugelassen hat. Denn dass sie sich zu helfen weiß, hat sie vorher nicht als Stärke gesehen. Wohl eher als notwendiges Überlebensmittel: Wer auf seine Elten nicht bauen kann, muss lernen, die Dinge mit sich allein abzumachen. Und Lösungen zu finden.
Der lernt dann aber auch, immer Stärke zu zeigen, alle Gefühle zu unterdrücken und vor allem nie schwach zu erscheinen. Sodass die Menschen drumherum meist gar nicht merken, was da los ist, dass da jemand auch verbrennen kann und sich völlig verausgabt. Ist ja ein beliebter Nachruf-Spruch: „Sie war immer für andere da.“
Nur für sich selbst nicht. Und auch nicht für das Kind in sich, das nach Trost ruft, Verstandenwerden, Zuspruch. Und was sie besonders schmerzt ist, dass sie sich so auch den eigenen Kindern gegenüber verhalten hat.
Alles schaffen müssen
Es ist eine sehr lebendige, sehr aufmerksame Geschichte geworden, die Christine Koschmieder hier aufgeschrieben hat. Ihre Sicht auf die Dinge, wie sie geschehen sind. Und was daraus wird, ist ein vollständiges Leben – nicht geglättet, nicht geschönt. So, wie es vielen passiert, auch mit Eltern, die auf Fragen nicht antworten.
So manche Leserin, aber auch mancher Leser wird sich wiederfinden in Sätzen wie: „Eine Stimme in mir schreit, doch, natürlich ist das wichtig, tritt doch endlich für dich ein. Ich will doch wissen, wie es dir geht. Meine Mama hat mich das nicht gefragt, als ich ein Kind war. Siehst du denn nicht, dass ich versuche, es besser zu machen? Ich sehe nur mich, fühle mich ungerecht behandelt. Schon wieder.“
Aber wahrscheinlich werden die, die das noch immer so erleben, dieses Buch nicht lesen. Überhaupt keine solchen Bücher lesen. Wer wird sich denn mit seinen Gefühlen beschäftigen, wenn man den Tag durchstehen muss, funktionieren, alles schaffen, nicht aufzugeben?
Es ist ein nicht unwesentlicher Teil unserer Gesellschaft, der so ist – blind für die eigene Not, sprachlos, wenn es wirklich um die Gefühle der Kinder geht. Und der erwachsen gewordenen Kinder, die auch nie Kind sein durften. Das vererbt sich augenscheinlich fort und fort. Und alle denken, es muss so sein.
Es steckt eine große Trauer in diesem Buch. Aber auch viel Mut, sich selbst im Spiegel zu betrachten und zu erzählen, was all das mit der Erzählerin angerichtet hat. Vielleicht ist das sogar der beste Weg, davon zu erzählen und die Gefühle zuzulassen. Ganz unsentimental. Stocknüchtern.
Dann überwältigen sie einen nicht. Man bekommt sie noch gebändigt. Manchmal gibt es eben kein Feuerwerk im Leben, keine große Erlösung, nur ein bisschen mehr Wissen darum, wie man so geworden ist. Und wie sehr sich darin die nie erzählte Geschichte der Eltern verbirgt, die einem so unbekannt gestorben sind, wie sie gelebt haben.
Bomberjackenwut
Sprachlosigkeit verwandelt sich dann in Wut. „Bomberjackenwut“. Auch Wut über sich selbst, die die Heldin nun in den Wald trägt, weil sie gemerkt hat, dass sie auch ihren Liebsten und die Kinder viel zu selten gefragt hat: Wie war dein Tag?
Und so handelt das Buch eigentlich nicht vom Trinken, sondern von dem, wofür der Griff zum Glas oft eigentlich steht. Dem, was wir uns zu selten zu sagen und zu fragen trauen. Die Fassade darf keine Risse bekommen und Schwäche darf man nicht zulassen.
Im Kapitel „Stellvertreterfeind“ wird das greifbar, wenn die Autorin schreibt von einem Moment, da sie vor lauter Gefühlen auf einmal Sehnsucht nach Rotwein bekommt, „mich der verlässlichen, vertrauten Beruhigung, Sedierung, Betäubung auszuliefern. Dass die Unruhe, dieses Ziehen in der Brust, dieses Gefühl, kurz vor dem Explodieren zu sein, nachlässt. – Und mir wird klar, dass es genau das ist, was ich nie auszuhalten gelernt habe. Diesem Gefühl ausgeliefert zu sein. Nichts dagegen tun zu können. Nichts tun zu können, damit es weggeht. Und wie ich immer versucht habe, dem durch Handeln zu entkommen. Exzessiv.“
Da kann ein ganzes Volk fleißig werden, einsatzbereit bis zum Umfallen oder bis zum Absturz. Es ist mehr als ein einzelnes Schicksal, das in dieser Geschichte steckt. Auch wenn es eine ganz persönliche und einzigartige Geschichte ist. Zutiefst berührend. Sogar tröstend. Wir können auch anders sein, wenn wir uns nicht sedieren, weil uns Gefühle zu viel werden.
Aber dazu braucht es sichtlich viel Mut, sich auch dem zu stellen, was wir nie bekommen haben. Aber es beim Namen zu nennen und zu schildern, wie man es selbst erlebt hat, könnte ein Anfang sein. Und Christine Koschmieder tut das – stilsicher. Lebendig, furios und auf eine mitreißende Art trocken.
Christine Koschmieder „Dry“, Kanon Verlag, Berlin 2022, 24 Euro.
,
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
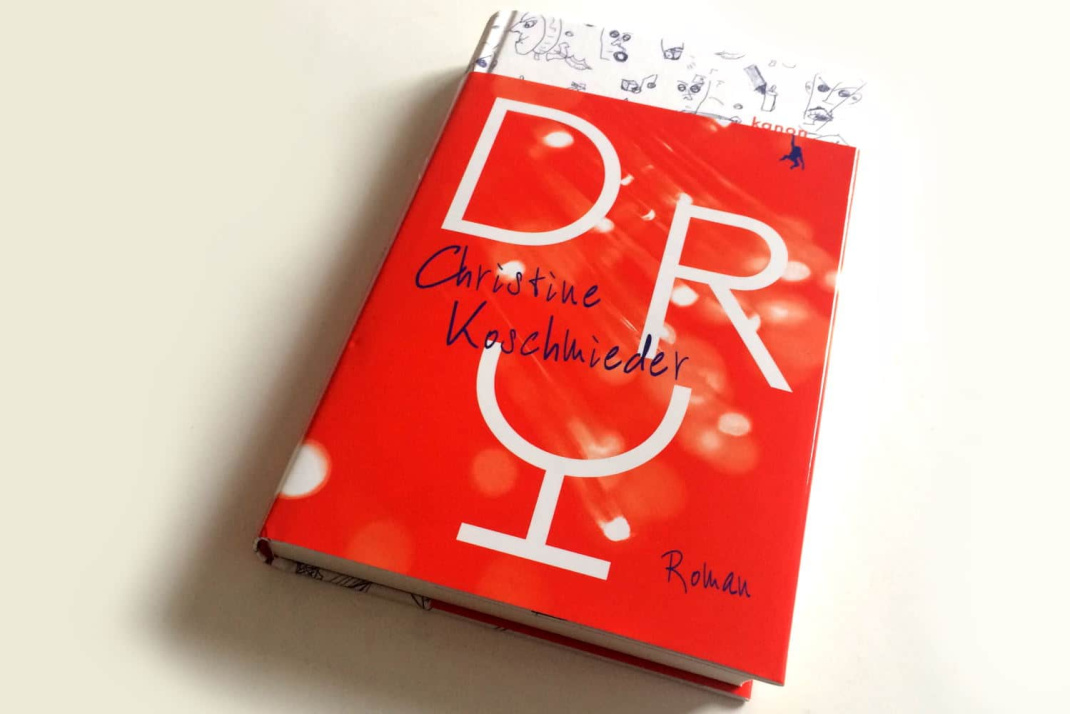


















Keine Kommentare bisher