Stundenlang versuche ich gemeinsam mit der Protagonistin, das Geschehene zu verarbeiten. Es gelingt uns beiden nicht: Vielleicht, weil es mehr ist, als Menschen verarbeiten können. Oder weil es immer noch so aktuell ist, dass mitten in Deutschland Menschen mit aller Selbstverständlichkeit ihre Rechte entzogen werden. Aber auch literarisch lässt mich das Buch mehrmals auf der Strecke.
Das Buch wird von einer jungen Psychologin erzählt, deren Name so selten fällt, dass man ihn sofort wieder vergisst. Sie beginnt, während andere in ihren Sommerurlaub fahren, die Arbeit in einer Unterkunft für Geflüchtete am Rand der Stadt. Ihre Kollegin Ines arbeitet schon lange in diesem Bereich. Das Buch erzählt von einer schlaflosen Nacht der jungen Psychologin.
Nach einem einschneidenden Erlebnis in der Unterkunft sucht sie nach Umgang mit dem und Verarbeitung des Geschehenen. So wird die Gegenwart, in der sie nach Worten sucht, aus dem Fenster starrt und sich ein Bier beim Späti holt, beschrieben, wie auch die Vergangenheit vom Beginn der Arbeit in der Unterkunft an.
Das Buch bespricht Themen, die nie aufgehört haben, aktuell zu sein: Nur selten gibt es einen so detaillierten Blick in eine Unterkunft für Geflüchtete. Es wird klar, dass es keine Gesundheit in einem kranken System geben kann. Es wird sichtbar, wie unmenschlich der Zustand des Wartens im Asylverfahren ist und dass die Bedingungen, unter denen die Menschen leben müssen, nicht tragbar sind. Alles, was die Psycholog*innen tun können, ist, Medikamente zu verschreiben und an regelmäßige Bewegung und Essen zu erinnern.
Lähmende Handlungsunfähigkeit
Idealistisch beginnt die Hauptfigur ihre Arbeit in der Unterkunft. Sie will etwas Gutes für die Menschen dort tun, wird jedoch schon in den ersten Sätzen ihrer neuen Kollegin Ines von diesem Thron heruntergeholt: So schnell wie die Leute wieder weg seien, könne man sich nicht einmal ihren Namen merken. In den Akten werden die Menschen mit Zahlen eingetragen, symbolisch für die Zahlen im System, zu denen die Geflüchteten gemacht werden.
Schnell wird der Hauptperson klar, wie gering der Handlungsspielraum ist, den sie hat. Psychologische Hilfe ist unmöglich an einem Ort, wo die Menschen auf engstem Raum zusammen leben, wo es keine Privatsphäre, sondern nur Bettwanzen gibt. Wo Menschen Traumata erlebt haben, die nicht gut genug behandelt werden können. Zusätzlich haben die Psycholog*innen für die Kulturen der Geflüchteten überhaupt kein Wissen oder Verständnis.
So wird immer wieder das Spannungsfeld zwischen Religion und Psychologie thematisiert. Anfangs scherzt die Hauptfigur, ob die Bücher mit den Diagnoseschlüsseln an diesem Ort Koran und Bibel seien. Irgendwann stellt sie tatsächlich die Sinnhaftigkeit der „Verwissenschaftlichung“ der Menschen infrage. In ihrer eigenen Sprache versteckt sie sich zwar hinter Fachbegriffen und Diagnosen, lässt trotzdem immer wieder die Menschlichkeit der Klient*innen durchscheinen.
Sie entwickelt ein Verständnis dafür, dass Gebete und Glauben Menschen helfen können. Sie beginnt die Abneigung einiger Klient*innen der Psychologie gegenüber mit ihrer Abneigung zur Religion zu vergleichen. Beides seien Glaubenssysteme. Nur wolle das eine objektive Wissenschaftlichkeit und Wahrheit behaupten.
Als sie einen Klienten wegen akuter Selbstgefährdung auf Anweisung von Ines mit der Polizei abholen lässt, um ihn in die Klinik zu bringen, wird ihr klar, wie unmenschlich diese Behandlung ist. Gleichzeitig zeigt sich die Ausweglosigkeit aus dem Asyl- und dem Psychiatrie-System: Denn der Versuch, andere Lösungen zu finden, endet fatal. Das Ende überrascht kaum noch. Fraglich ist nur, warum es so lange unausgesprochen bleibt: um künstliche Spannung zu erzeugen oder weil es sich nicht aussprechen lässt.
Es bleibt an der Oberfläche
Auch an anderen Stellen hinterlässt das Buch bei mir den Eindruck, nicht mutig genug zu sein, für das, was es erzählen will. Die Hauptfigur etwal bleibt Projektionsfläche: Sie entwickelt keinen eigenen Charakter, sondern ist immer nachvollziehbar und durchsichtig. Zum Beispiel durch den Idealismus, mit dem sie die Arbeit in der Unterkunft beginnt oder durch die fehlende Abgrenzung zu ihrer Tätigkeit: Beides sehr nachvollziehbare und stellt menschliche Züge dar, welche die Figur aber leer statt plastisch machen.
Es gibt nur inhaltliche, moralische Spannungen, keine bezogen auf ihren Charakter. Der Text zeigt sie nur in ihrem Arbeitsumfeld und, als sich die Arbeit bis nach Hause erstreckt, auch dort. Schlaflos brütet sie über den Fällen und googelt nach asylrechtlichen Möglichkeiten für die Klient*innen aus der Unterkunft.
Für mich ist der Eindruck entstanden, dass die Hauptfigur nicht aus dem Verstecken heraus kommt. Dem Verstecken hinter psychologischen Begriffen und hinter Arbeitsabläufen. Das ist insoweit nachvollziehbar, hat aber sehr an der Tiefe des Buches gezerrt: Themen hätten weniger oberflächlich besprochen werden können. Denn die Themen des Buches liefern viel Stoff, bei mir bleibt aber der Eindruck, dass sie eher symbolisch verhandelt werden: wodurch auch die Figuren des Buches zu bloßen Symbolen verkommen, an denen etwas gezeigt werden soll.
So dient die Einweisung eines Klienten in die Psychiatrie dazu, die Gewalt des Systems zu zeigen. Eines Systems, in dem Psycholog*innen eine Fremdgefährdung feststellen und damit gegen den Willen des Klienten entscheiden dürfen. So scheint der Satz, seit der Klient die Antidepressiva nehme, habe er alle seine Gebete vergessen, symbolisch für das kulturelle Unverständnis.
Damit scheint der Fluss, der die Unterkunft vom Rest der Stadt trennt und sich mit der Handlung verwebt, ein Symbol für eine Grenze, die nur diejenigen mit den richtigen Papieren übertreten dürfen.
Theresa Pleitner „Über den Fluss“, S. Fischer, Frankfurt 2023, 22 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
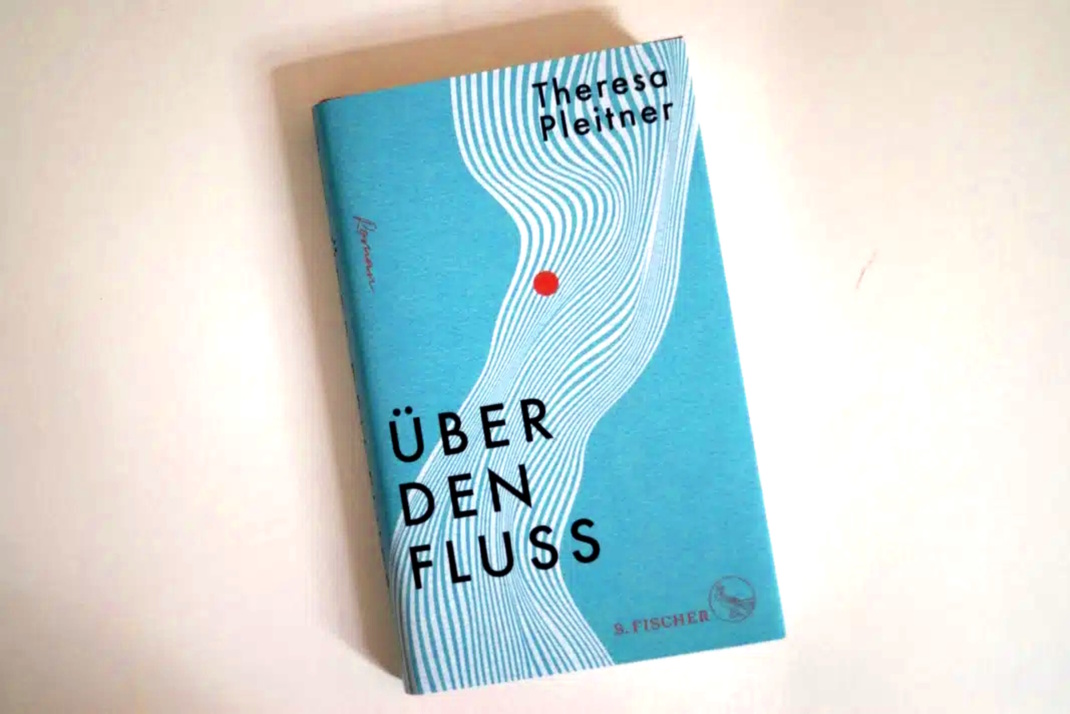














Keine Kommentare bisher