Auch diese Stimmen gehören dazu, wenn über den deutschen Osten geschrieben wird, ostdeutsche Schicksale und das Versagen von Politik. Einer Politik, die ihre Wähler gern mit flapsigen Sprüchen einlullt und Probleme negiert, statt sie zu lösen. Und mit diesem Buch, in dem Samuel Meffire seine Lebensgeschichte erzählt, geht es zurück genau in jene Jahre der sächsischen Wirklichkeitsverdrängung. Auch wenn König Kurt mit keinem Wort erwähnt wird.
Dafür der Minister, den er dann eiskalt abservierte, weil er ihm zu selbstbewusst war und seinen Machtanspruch in der sächsische CDU gefährdete: Heinz Eggert, von 1991 bis 1995 sächsischer Staatsminister des Inneren. Und damit Vorgesetzter des Polizisten Samuel Meffire, der bei seinem Eintritt in den sächsischen Polizeidienst schon eine Ochsentour der Niederlagen und immer neuen Anfänge hinter sich hatte. Beinah so wie alle Ostdeutschen zu dieser Zeit.
Aber eben nur beinahe. Denn als Sohn eines Mannes aus Kamerun, der in die DDR gekommen war, um hier zu studieren, und einer ostdeutsche Programmierin 1970 in Zwenkau geboren, ist er etwas, was es in den sozialistischen Schablonen des Ostens eigentlich nicht geben sollte: ein dunkelhäutiger DDR-Bürger, auffällig in einer Gesellschaft, die bis 1990 flächendeckend „weiß“ war und das Fremde bestenfalls mal als „Gastarbeiter“ erlebte.
Offiziell galt ein medienwirksamer Internationalismus, mit dem auch Samuels Vater damals bei einem Aufbaueinsatz in Leipzig in Szene gesetzt wurde. Just an dem Tag, an dem er Sams Mutter kennenlernte und eine Familiengeschiche begann, die in einem anderen Land zu einer anderen Zeit vielleicht gut gegangen wäre.
Vielleicht.
Denn die „Orks“ und „Vampire“, wie sie Samuel Meffire nennt, gibt es überall. Ihnen genügt, dass Menschen anders aussehen, um sie zu Freiwild zu erklären und tatsächlich zu jagen. Und 1990, als die Mauer gefallen war und ein Landesteil sich holperig aufmachte, zu einem ebenbürtigen Teil einer Demokratie zu werden, waren sie auf einmal da. Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda sind Synonyme für diesen organisierten Mob, in dem „kampferprobte“ Rechtsextreme aus Westdeutschland ihrem kahlgeschorenen Nachwuchs im Osten zeigten, wie man Terror schürt und die Leerräume mit Gewalt nimmt, die die Staatsmacht hinterlassen hat.
Sachsens Sehschwäche rechts
Eine Staatsmacht, die eiligst die alten Staatsorgane der DDR abwickelte und für mehrere Jahre ein Vakuum schuf, in dem es landauf, landab zu wenige Polizisten gab. Jahre, die nicht grundlos heute unter dem Label Baseballschlägerjahre bekannt sind. Wer ins Raster der bestens organisierten Rechtsradikalen passte, wurde zum Freiwild. Und auch Samuel Meffire erlebte diese Menschenjagden mit, damals in Dresden-Neustadt, das eben noch Tummelplatz einer „Bunten Republik“ war und schon wenig später der Ort, an dem ein gewalttätiger Mob seine Opfer suchte. Und fand.
Eine Zeit, die Meffire mit schierer Angst verbindet. Und er erzählt, wie real diese Angst war. Und wie er sie immer wieder neu zu bändigen versuchte. Auch indem er sich der Realität stellte und als Sozialarbeiter und Polizist versuchte, seinen eigenen Beitrag zu leisten, dass dieses Land wieder sicherer wurde. Nur um immer wieder neue Rückschläge zu erleben. Denn verantwortliche Minister wie Heinz Eggert waren rar gesät, sind sie bis heute.
Eggerts Nachfolger verfielen so ziemlich alle in die alten Gewohnheiten – dünnten die Polizei aus, ignorierten die Ausbreitung rechtsextremer Strukturen im Land. Dass Sachsen heute so aussieht, wie es aussieht, hat mit dieser Zeit der Ignoranz zu tun, des Schönredens und Verleugnens.
Und des Alleinlassens. Denn Menschen wie Meffire erlebten immer wieder, dass sie mit der dauerhaften Gefahr allein fertig werden mussten. Wobei bei ihm noch etwas Anderes hinzukam, über das er erst ganz zum Ende sprechen kann, als er in Bonn längst ein neues Zuhause, eine Familie und eine gute Arbeit gefunden hat: dass hinter seinen vielen Niederlagen, die er damals erlebte, auch seine eigene lebenslange Suche nach einer Vaterfigur steckte.
Der ermordete Vater
Denn an dem Tag, als er geboren wurde, starb sein Vater, vergiftet von seinen eigenen Kommilitonen, die auf diese Art ihre Verachtung für den jungen Mann aus Kamerun zum Ausdruck brachten. Doch an Aufklärung war in diesem Jahr 1970 nicht zu denken. Der Fall wurde vertuscht. Die Mutter stand mit ihren beiden Söhnen allein da. Und das hatte Folgen.
Folgen, die auch Jungen mit weißer Hautfarbe durchaus kennen dürften. Damals ging so manche Familie kaputt und so mancher Vater ging verschüttet. Auch das hat die ostdeutsche Gesellschaft verändert. Und junge Leute in Milieus getrieben, die einem auch 30 Jahre später noch eine Gänsehaut machen.
Und hier kam hinzu: Der Rassismus hat hier nicht nur eine Liebe zerstört, sondern eine ganze Familie. Der Alkohol zerstörte dann endgültig, was vielleicht noch an Kraft und Liebe vorhanden war. Die zwei Jahre, die der kleine Sam bei seinem Großvater in Dresden wohnen durfte, erscheinen selbst dem erwachsenen Erzähler, der seine ganze Kindheitsgeschichte nun den neugierigen Töchtern erzählt, noch wie das Paradies.
Dass seine Jugend just in dem Moment endete, als auch die DDR in die Knie ging, gehört zur Dramatik dieses Lebens. Aufstehen. Wundenlecken. Weitertrainieren. Und eigentlich hätte alles gut werden können, wäre ihm bei der Kripo in Dresden nicht schon wieder eine Vaterfigur verloren gegangen, ein respektierter Vorgesetzter, der gehen musste, weil er einigen Leuten zu nah auf den Pelz gerückt war. Kurz bevor auch der Innenminister gehen musste und Meffire seinen Job als Polizist kündigte. Nur um jetzt erst recht in gefährliches Fahrwasser zu geraten und ein kriminelles Milieu, das ihn letztlich zum Verbrecher machen sollte.
Der stillschweigende Rassismus im Land
Die Flucht führte ihn bis nach Afrika, wo er mitten in einen Staatsstreich gerät, aufgeben muss und heimkehrt nach Deutschland, wo der Prozess auf ihn wartet und die Drohung des einstigen Bosses der Dresdner Unterwelt, ihn von einem russischen Killer eliminieren zu lassen. Der Leser jedenfalls dürfte nicht wirklich zur Ruhe kommen beim Lesen. So etwas denken sich Romanautoren extra aus, um ihrem Krimi richtig Spannung zu verleihen.
Aber wenn man die ganze Zeit weiß, es ist ihm wirklich passiert – bis hin zu den acht Jahren Gefängnis, in denen sein Leben auch nicht sicher war, dann bleibt die Frage tatsächlich wach: Ist dieses Deutschland für Menschen, die sich nicht hinter ihrer Hautfarbe verstecken können, tatsächlich so? Und wie können sie anders damit umgehen, als indem sie sich völlig verleugnen, klein machen, den immer als gefährlich empfundenen Weißen möglichst aus dem Weg gehen?
Ist unser Land tatsächlich so rassistisch?
Zumindest lässt es all diesen Rassismus zu. Der wie ein Ventil wirkt für all die jungen Männer mit weißer Hautfarbe, die ihre eigenen Abwertungserfahrungen machen und den gebündelten Hass dann auf die Menschen anderer Hautfarbe fokussieren. Ein nicht unwichtiger Gedanke.
Der auch mit Samuel Meffires Weg zu sich selbst zu tun hat. Denn so ein Buch schreibt man ja nicht, wenn man wirklich gescheitert ist. Wenn man trotz aller Schikanen nicht doch den kleinen Mut zum Leben bewahrt hätte und den Anstoß angenommen, sich mit den Gründen für all das Scheitern zu beschäftigen.
Und wenn es der fehlende Vater ist, den Samuel Meffire ja nie kennenlernen konnte. Und mit seiner Suche nach wirklich starken Vaterfiguren selbst im Berufsleben ist er garantiert nicht der einzige in Deutschland. Nur hat das eben auch die Kehrseite, dass Viele sich dann an falschen Vaterfiguren orientieren. Und dann doch nie lernen, selbst zu denken, selbst zu fühlen und für sich selbst Verantwortung zu übernehmen.
Und auch der Verdacht wird hellwach: Dass unser Land nicht wirklich reich ist an guten Vatervorbildern. Denn auch davon zehrt der alte und der neue Faschismus: von falschen Vaterbildern, falschen Führergestalten, die Gefolgsleute suchen, aber keine wirklich selbstbewussten Nachfolger.
Ein ostdeutsches Schicksal
Ein verzwicktes Buch zu einer verzwickten Lebensgeschichte, über viele Seiten wirklich harter Stoff, bei dem man mitfiebert und trotzdem nicht in der Haut von Samuel Meffire stecken möchte. Obwohl er sich nie wirklich aufgibt – auch wenn ihm oft genug danach ist.
So betrachtet ein durch und durch ostdeutsches Schicksal von einem, der immer wieder aufsteht und Neues probiert und festen Grund sucht für sein Leben. Was natürlich die Herren der aufgeblasenen Sorte, die das Beleidigen von Menschen anderer Hautfarbe für normal halten, nie begreifen werden.
Das „Ich, ei Sachse“ steht vollkommen zu Recht auf dem Titel. In anderer Variation kennen auch die hellhäutigen Altersgenossen von Samuel diese Rumpeltour, dieses Schwanken zwischen Euphorie und dem Gedanken ans Aufgeben. Um dann trotzdem wieder neu anzufangen. Auch wenn es den meisten erspart blieb, den bitteren Kelch derart bis zum Boden leeren zu müssen.
Verfilmt ist die Geschichte übrigens auch schon. Ab dem 26. April hat der Film in sieben Folgen auf Disney+ Premiere. Und für viele Jüngere wird es ein Stutzen sein, weil sie diese harte und bittere Seite der ostdeutschen Zeit vor und nach der „Wende“ nicht kennen. Bestenfalls die Stereotype über die Nazis, die auch heute noch trommelnd durch sächsische Kleinstädte marschieren, weil eine machtverliebte Partei einfach nicht sehen will, was Nazinetzwerke tatsächlich in den Köpfen und Seelen der Menschen anrichten.
Denn eines funktioniert nun einmal nicht: Den Menschen allein zu lassen in seiner Not, wie das die heutige Ellenbogengesellschaft so gern tut. Das trifft natürlich zuerst die Schwächsten und Ausgegrenzten. Und wie Samuel das alles wegsteckt, erstaunt schon. Andere wären an solchen Schicksalsschlägen zerbrochen oder hätten jeden Mut zum Leben verloren.
Eine deutsche Geschichte
So betrachtet, ist das nicht nur eine sächsische oder ostdeutsche Geschichte, sondern eine gesamtdeutsche. Eine darüber, wie wir wirklich miteinander umgehen und gerade mit den Menschen aus all den Milieus, wo Benachteiligung und Ausgrenzung zum Alltag gehören.
Wenn das nicht wirklich zur elementaren Frage wird, werden Menschen wie Samuel Meffire zwar nur zu gern für Integrationskampagnen als Posterboys benutzt.
An ihren tatsächlichen Diskriminierungen ändert sich aber nichts. So, wie er ja als Polizist tatsächlich zum sächsischen Posterboy wurde. Ein schön diskutables Thema, wie die Marketingagentur damals meinte. Nur: Wer war eigentlich der Adressat? Wem gilt die Botschaft? Und wer ändert das gesellschaftliche Klima, sodass das ganz und gar nicht lächelnde Gesicht eines dunkelhäutigen Polizisten in Sachsen nicht mehr als exotisch gesehen wird?
Auch wenn es Meffire nur an der kurzen Begegnung mit Heinz Eggert schildert, spürt man, dass das mit politischer Schönwetter-Inszenierung sehr viel zu tun hat. Mit Politikern, die in Sachsen selbst an keine Nazis sehen wollen, wenn die in Horden prügelnd durch Dresden (oder Hoyerswerda) streunen.
Auch so gesehen – eine sehr sächsische Geschichte. Zum Mitfiebern. Zumindest für all jene, die ihre Menschlichkeit nicht einfach an den Nagel gehängt haben, als sie mal jung waren.
Samuel Meffire mit Lothar Kittstein „Ich, ein Sachse. Mein deutsch-deutsches Leben“, Ullstein extra, Berlin 2023, 19,99 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
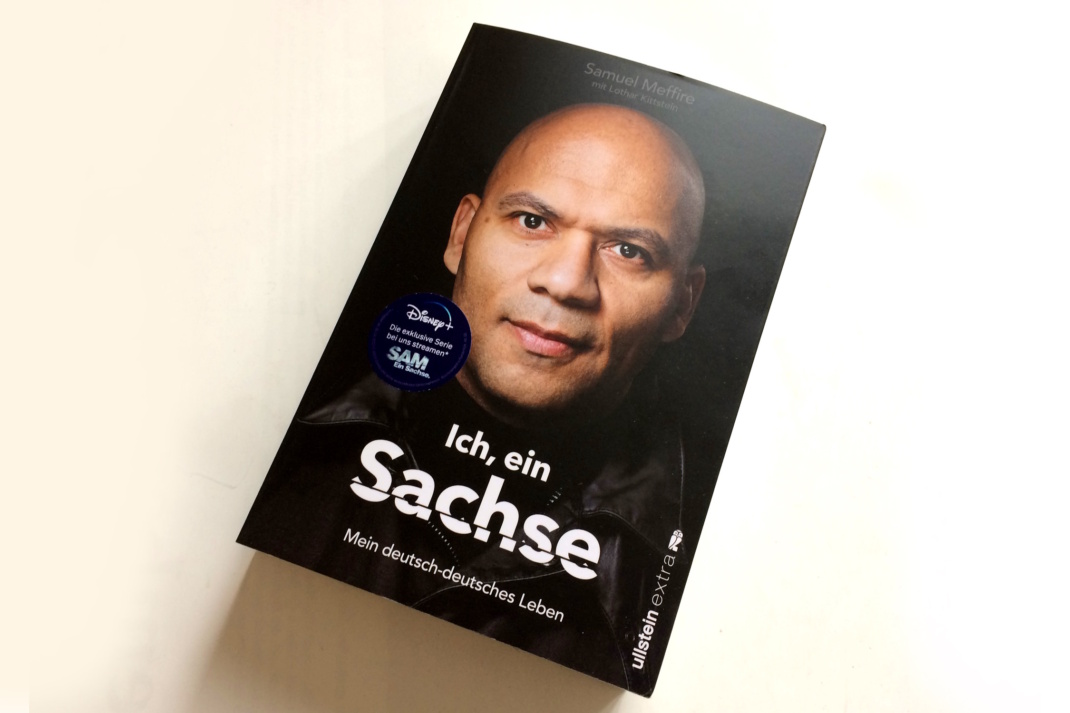



















Keine Kommentare bisher