„In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal, was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt.“ Sie tauchten oft auf in mir in letzter Zeit, die knorrig-churchillartigen Gedanken des lebensweisen Egon Bahr (1922–2015), des ehemaligen Oststrategen der SPD. Und lang ist´s nun auch schon her, gemeinsame Kahnpartien oder Picknick am Fluss zwischen Kanzler und sowjetischem Generalsekretär, irgendwo in den Weiten Russlands.
Selbst diese Entspannungspolitik der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, an der der frühere Staatssekretär und Bundesminister Bahr, einen bedeutenden konzeptionellen Anteil hatte, wandelt sich in gegenwärtiger Betrachtung zum historischen Fehler. „Dem Russen ist eben nicht zu trauen …“ Bekanntes Mantra? Sicher doch. Wie würden Bahrs Gedanken heute – im Gewand eines nüchternen Beschreibens daherkommend – zum aktuellen Russland-Ukraine-Konflikt lauten? So etwa vielleicht …
„Dieser russische Angriffskrieg seit Februar 2022 und die damit verbundenen weltpolitischen Konsequenzen sind ein großer Rückschritt im Fortschreiten der Menschheit. Bei der Lösung ihrer eigentlich existenzgefährdenden Probleme. Diesen Völkerrechtsbruch mit dem Überfall auf die Ukraine können nur die falschen ‚Humanisten‘ richtig finden. Und politische Kreise, die an diesem Konflikt interessiert waren und sind. Die demzufolge eine lange und verlustreiche Kriegsdauer in Kauf nehmen, akzeptieren oder auch anstreben. Er ist aber in erster Linie eine Niederlage für alle diejenigen, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten auf die Karte des friedlichen Interessenausgleichs zwischen den Nationen und der gemeinsamen Verantwortung für das Weiterbestehen unseres Planeten gesetzt haben.“
Klingt etwas Politiker-schablonenhaft, trifft aber die traurige Wahrheit. Vielleicht auch mit einem (zu) großen Überschuss an utopischem Humanismus als allgemeine Philosophie. Mag sein. Bedrückend ist das schon, registrieren zu müssen, dass in den Reihen der großen Sozialdemokratie, der Klingbeils und Barleys sich niemand findet, der den aktiven Mut zum Frieden hat. Den Mut und die Entschlossenheit, den „Gordischen Knoten“ zu lösen, der bei der Verwicklung westlich orientierter und russisch-autokratischer Interessen entstanden ist.
Der unauflösbar erscheint, weil wieder einmal zwischen Sieg- und Verständigungsfrieden gerungen wird. Mit täglich neuen Opfern. Wobei stark zu bezweifeln ist, dass die Toten des Krieges und deren Mörder auch wirklich die verfeindeten Menschengruppen beider Seiten darstellen. Ist es nicht vielmehr – erneut Bahrs Gedanken aufgreifend – die Politik, die den Völkern der verfeindeten Länder und Blöcken erklärt, warum man sich auf Krieg einrichten und Kampf für Interessen einstellen muss?
Scheint so, dass Frieden nicht die beste aller Ordnungen für unseren Planeten ist. Vielleicht sollten wir die Offenbarung des Johannes, die biblisch beschriebene Apokalypse in Dauerbeschallung statt der Nationalhymne kurz vor Mitternacht in den Rundfunkanstalten senden? Versteht nur niemand. Und ließe niemand zu.
Stattdessen sind die sieben Jahre nach Bahrs Tod überhörten Mahnungen leidenschaftlichen Gefühlen von Resignation und Wut gewichen. Zwischen Friedensengagement, Gedanken zum Tyrannenmord und/oder Rettung durch die NATO. Wissen, Kenntnisse und politischer Tiefblick sind im Moment wenig wert, wenn vieles propagandistisch angehaucht daherkommt, eindimensionale Berichterstattung die Eskalationsschraube stärker anzieht.
Das Mitfühlen mit dem Schicksal jedes Einzelnen dadurch aber diskreditiert erscheint, wenn zwischen getöteten Menschenleben unterschieden wird. Hier die Guten, da die Bösen. Ist es nicht möglich, Sicherheit – wie in der Entspannungspolitik der Brandts und Schmidts und Bahrs formuliert – als Sicherheit des jeweils anderen zu verstehen? Sodass man deeskalierend kommuniziert. Zwischen den neuen Blöcken, Achsen oder Gemeinschaften. Momentan scheint es allerdings, als ist die Sprache des Friedens ausgestorben. Als sei sie nicht überlebensfähig.
Nicht überlebensfähig. Dieses Selbstzeugnis stellte sich der 1881 geborene Stefan Zweig am Ende seines Daseins aus. Zwei Weltkriege hatte der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig sehen, in zwei „Bruderkriegen der Menschheit“ mitleiden müssen, bis er sich 1942 im brasilianischen Exil desillusioniert das Leben nahm.
Man muss diesen begabten Erzähler nicht vorstellen, jeder und jede hat seine „Sternstunden der Menschheit“ (1929 in Leipzig erschienen) schon einmal in den Händen gehabt; hat gelesen, wie der Pazifik 1513 entdeckt wurde, die Marienbader Elegie 1823 unter Goethes Hand entstand und die Russische Revolution von 1917 ausbrach … Zweig schildert Geschichte, ihre „Sternstunden“, so spannend wie ein Krimi, schrieb großen Persönlichkeiten postum ein großes Memento, von Castillo bis Calvin, von Hölderlin bis Kleist.
Seine Erinnerungen erschienen 1944, zwei Jahre nach seinem Tod. In der „Welt von Gestern“ vermag der sensible Autor nicht nur meisterhaft literarisch zu erzählen. Sie liest sich beängstigend spannend, die romaneske Lebensbilanz eines resignierten Emigranten in „finsterer Zeiten“ (Brecht). Man möchte diesem so traurig klingenden Schöngeist postum den Friedens- und Literaturnobelpreis verleihen, wenn er bereits im Vorwort von den „fahlen Rossen der Apokalypse“ schreibt, welche durch sein „Leben gestürmt“ seien, bewundert diesen Verve an poetischer Kraft angesichts politischer Lähmung.
Die „Erzpest des Nationalismus“ hielt Stefan Zweig für die wohl schlimmste der „großen Massenideologien“. Dieser habe bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts die „Blüte der europäischen Kultur vergiftet“. Warum gerade jetzt noch einmal Stefan Zweig, warum gerade dieses Buch? Mir kam es nach dem Schock und dem Entsetzen am 24. Februar so ziemlich rasch wieder in den Sinn. Nach Jahrzehnten gefühlter Ruhe im Weltgeschehen – obwohl dies nie wirklich stimmt – schlägt es wie ein Blitz in die Alltagsroutine ein, wenn nicht weit entfernt ein Krieg ausbricht und er mit zahlreichen Opfern unter uns auftaucht.
Der Blick in eine „Welt von Gestern“ vor der aktuellen Kulisse modernen Mordens fördert erstaunliche Parallelen zutage: Das Denken, politische Probleme militärisch zu „lösen“, fegt schnell, und zwar ganz schnell ein humanes Kulturbewusstsein zur Seite. Und dieses Denken wird mit halb-humaner Finallogik, natürlich emotional aufgeladen, dem Massenpublikum als „alternativlos“ präsentiert.
Klingt etwas kompliziert, war bzw. ist aber barbarisch einfach. Und schon einmal dagewesen: Aus der „Julikrise“ 1914 erwuchs „die Urkatastrophe“ des Weltkriegs mit über 10 Millionen Toten, nach 4 Jahren, müde, erschöpft, tot. Keine „Sternstunde der Menschheit“. Warum der ganze Wahnsinn? Weil man sich im west-östlichen Interessengegensatz eingerichtet hatte, und glaubte, ökonomisch-expansive Ziele nur militärisch durchzusetzen.
Und immer fühlte sich jede Seite von der jeweils anderen bedroht. (Kein Wunder, bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde um die Wette gerüstet). Den Anlass à la grande guerre lieferte ein Attentat. 28. Juni 1914 in Sarajevo, der bosnischen Hauptstadt. Und niemand hielt es für einen „Grund zum Krieg“. So schrieb Zweig „Nichts aber deutete an, daß dies Ereignis zu einer politischen Aktion gegen Serbien ausgewertet werden sollte.“
Wenige Wochen später zogen singende Soldaten mit Blumen auf den Gewehren los, um sich kurz danach in Schützengräben wiederzufinden. Denn: „… die schlimmen Nachrichten häuften sich und wurden immer bedrohlicher. Erst das Ultimatum Österreichs an Serbien, die ausweichende Antwort darauf, Telegramme zwischen den Monarchen und schließlich die kaum mehr verborgenen Mobilisationen.“
Wir schauen und reiben uns gegenwärtig die Augen, wo wir wieder gelandet sind. In einer „Welt von Heute“, die so fatal im Bellizismus zu versinken scheint, Waffenarsenale aufstockt und Menschen in Kriege schickt, die sie ewig fortzusetzen bereit scheint. Welch ein Wahnsinn. Zweigs größter Wunsch wäre vermutlich gewesen, in einer zukünftigen Welt wieder aufzuwachen – möglicherweise hätte er sie „Friedliche Welt der Zukunft“ genannt.
Stefan Zweig, „Die Welt von Gestern“, Fischer Verlag, 204 S.
„Überm Schreibtisch links – Die Welt von Gestern“ erschien erstmals am 29. April 2022 in der aktuellen Printausgabe der Leipziger Zeitung (LZ). Unsere Nummer 101 der LZ finden Sie neben Großmärkten und Presseshops unter anderem bei diesen Szenehändlern.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
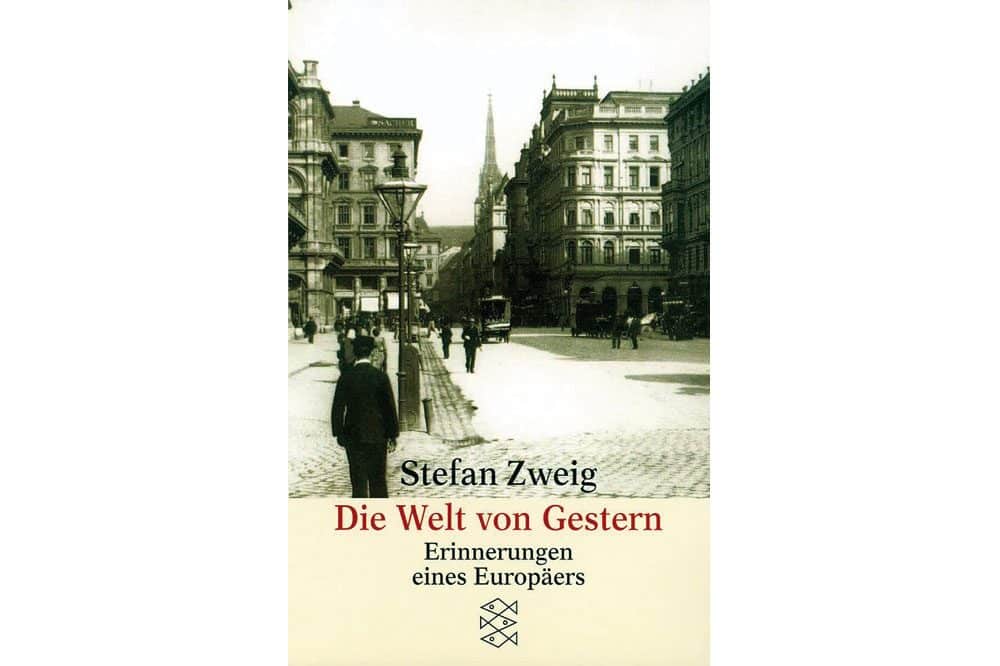













Keine Kommentare bisher