Schon einmal hat sich Regine Möbius mit dem hochpolitischen Wirken von Erich Loest beschäftigt. 2009 erschien ihr Buch „Wortmacht und Machtwort“. Das erlebte der Ehrenbürger Leipzigs noch mit. Da war er 83 und die Zipperlein des Alters machten ihm schon zu schaffen. Aber ans Aufhören dachte er gar nicht. Seinen Erfolgsroman „Völkerschlachtdenkmal“ erweiterte er noch einmal zu „Löwenstadt“. Leipzig blieb immer seine große Wut und Liebe.
Die Trauerfeier fand 2013 in jener Kirche statt, die einem anderen seiner großen Romane den Titel gab: der Nikolaikirche. Aber beerdigt werden wollte er in seiner Geburtsstadt Mittweida. Also doch ein Bruch mit Leipzig?
Nicht wirklich. Sein Nachlass lagert gut behütet in der Villa Ida. Und seine Romane werden weiter von seiner grimmigen Beziehung zu jener Stadt erzählen, in die er kurz nach dem Kriegsende kam, wo er sich als Journalist bei der LVZ seine Sporen verdiente und mit dem Nachkriegsroman „Jungen die übrig blieben“ seinen ersten Schritt als Schriftsteller tat. Ein echter Bucherfolg, der ihn aber nicht davor bewahrte, ab 1953 immer wieder in die Mühlen seiner eigenen Partei zu geraten.
Denn die Sache mit dem Sozialismus nahm er ernst – immer wieder mischte er sich ein mit Texten, die zur Debatte aufriefen. Aber Debatte war nicht gewollt. Und nach dem Ungarn-Aufstand 1956 zeigte die Ulbricht-Regierung, dass sie in Krisenzeiten ganz bestimmt nicht bereit war, den Dialog zu suchen, sondern zu stalinistischen Methoden griff.
Die Zuchthauszeit in Bautzen sollte Erich Loests Leben prägen, auch wenn er sein großes Herz für die Menschen nie verlor, für die „kleinen Leute“. In einer kleinbürgerlichen Familie aufgewachsen, wusste er noch, was diese Formel bedeutet. Wofür es sich lohnt zu kämpfen. Die Heldinnen und Helden seiner Romane erzählen davon. Er hatte „Wortmacht“, die „Machtworte“ sprachen andere.
Aber wie fasst man so ein Schriftstellerleben? Kann man es überhaupt erfassen? 2009 hat es Regine Möbius erstmals versucht und sehr anschaulich gezeigt, wie eng bei Loest das Engagement für eine bessere Gesellschaft immer mit seinem Schreiben verbunden war. Immerhin gehörte er zu den Schriftstellern, die ihre Romane immer aus dem Stoff der Gegenwart webten – wenn es ihm nicht geradezu untersagt war wie nach seiner Haftverbüßung 1964, als er sich ins Krimi-Genre rettete, denn ohne zu schreiben konnte er nicht leben.
Und mit „Swallow, mein wackerer Mustang“ holte er den berühmtesten aller sächsischen Autoren wieder aus dem Giftschrank. Allein dafür würden ihn die Sachsen schon lieben. Aber das Selbsterlebte wollte verarbeitet sein. Und als der neu ins Amt gewählte SED-Chef Honecker dann eine Hoffnung nach der anderen zerplatzen ließ, wurden die Handlungsspielräume für diesen Autor, der ohne Wirkmacht nicht leben konnte, immer kleiner.
Akribisch erzählt Regine Möbius dieses Leben nach, das die Widersprüche der DDR wie wenige andere auf den Punkt bringt, bis hin zu Loests direkter Konfrontation mit den Funktionären, die ihn aus dem Schriftstellerverband mobbten und ihm eigentlich die Veröffentlichungsmöglichkeiten im Land unterbanden. Mit Zensurminister Höpcke hatte Loest ein eigenes Hühnchen zu rupfen, erst recht, nachdem dieser auch noch öffentlich log über das spezielle Dreijahres-Ausreise-Visum für Loest, das kein echtes Reisevisum war, eher eine – im Vergleich zur Biermann-Ausbürgerung – verstecktere Variante der Abschiebung.
Und auch schon in der ersten Variante des Buches erlebte man Loest im Westen weiter als Streiter, als einer, der den VS aufmischte und den Riss thematisierte, der sich zwischen den vielen ausgebürgerten Ostschriftstellern und den auf sich selbst fixierten Westautoren auftat. Ein Riss, den er nie ganz kitten konnte, was aber nicht an ihm lag.
Das Erstaunliche ist: Diese Debatte erinnert verblüffend an die Gegenwart, an die seltsame Wohnkultur eines zerrissenen Volkes, wo sich der Hauptmieter nur für sich selbst interessiert und die Gegenwart des östlichen Untermieters als blanke Störung begreift. Reicht es denn nicht, dass der Nörgler in derselben Wohnung wohnen darf und seine Miete abdrückt? Kann er sich nicht bescheiden? Was will er denn?
Loest wusste nur zu gut, was der Untermieter wollte. Denn das war das Schicksal vieler begnadeter Schriftsteller aus dem Osten, die im Westen kaum Widerhall, kaum Publikum fanden. Für die Renitenten im Osten interessierte man sich nur, wenn sie sich entweder für den Ost-West-Konflikt instrumentalisieren ließen oder sich professionell Gehör verschafften, so wie der gelernte Journalist Loest, der wusste, wie er im Radio und in den großen Zeitungen seine Texte und Positionen unterbringen konnte.
Als 1989 die Mauer fiel, war er im Grunde der einzige Schriftsteller, der schon kraft seiner Persönlichkeit in der Lage war, für beide Landesteile zu sprechen und Brücken zu bauen, Brücken auch in das viel zu oft und viel zu lange ignorierte Nachbarland Polen. Dass seit Mitte der 1990er Jahre viele eindrucksvolle polnische Autoren den Schritt auf den deutschen Buchmarkt schafften, ist auch Loests Verdienst.
Und auch nach seiner Rückkehr nach Leipzig 1990 wusste er ja die journalistischen Möglichkeiten zu nutzen und mischte sich via LVZ immer wieder massiv in städtische Nicht-Debatten ein, die oft erst durch ihn zu Debatten wurden. Sein Fehlen macht eigentlich erst spürbar, wie selten solche Wortmächtigen in Leipzigs Bürgertum sind. Was auch mit Eigenständigkeit zu tun hat: Um so vehement Position beziehen zu können – ob gegen das Marx-Relief oder für die Paulinerkirche – braucht es festen Stand.
Den haben nur wenige, weil die, die in Leipzig das Sagen haben, fast allesamt Abhängige und Bedienstete sind, Leute, durch die ihr Amt und ihre Abhängigkeit spricht, wenn sie reden. Ihr „ich“ ist fast immer ein amtliches „wir“. Ein Thema, das Loest auch ansprach, als er sich wünschte, die Stadt möge wieder neue Ehrenbürger/-innen ernennen. Was bis heute niemand mehr getan hat. Was Gründe hat. Auch seilschaftliche Gründe.
Weshalb man zumindest als Leser durchaus hadern durfte mit Loests gewaltiger Ehrerbietung vor der „Löwenstadt“. Vielleicht war er ja wirklich der Letzte, der so ein Wort ohne Sarkasmus benutzen konnte. Der mutigste Löwe in dieser Stadt heißt heute Leila. Aber man merkt bei Loest eben bis zuletzt, dass er immer das Leipzig seiner Jugend im Sinn hat, ein Leipzig, das für ihn mit großen mutigen Männern verbunden ist, mit Hans Mayer, Ernst Bloch, Siegfried Schmutzler, aber auch mit den Mutigen im Jahr 1989. Oder mit den Arbeitern von 1953, oder mit jenen Gleichgesinnten, die auch zu ihm hielten, als ihn die Parteibonzen zum Außenseiter machten.
Einer, der den Bildtitel „Aufrecht stehen“ selbst ernst nahm. Und selbst acht Jahre Kampf riskierte, damit dieses von ihm beauftragte Bild tatsächlich in der neuen Universität aufgehängt wurde – als Gegenstück zu Werner Tübkes Auftragswerk „Arbeiterklasse und Intelligenz“, in dem Loests schlimmster Feind, der SED-Bezirkschef Paul Fröhlich, abkonterfeit ist. Enthüllt werden konnte „Aufrecht stehen“ erst nach Loests Tod. Das ist eine der Geschichten, die Regine Möbius noch zu Ende erzählen musste. Ermutigt dazu hat sie Stephan Seeger, Direktor der Stiftungen der Sparkasse Leipzig.
Viel neuen Stoff brachte auch Loests Tagebuchband „Gelindes Grauen“, in dem sich der Autor noch immer als genauer Beobachter und nachdenklicher Zweifler bewies. Ein Tagebuchschreiber, der noch hellwach reflektiert, was ihm, seiner Stadt und der Gesellschaft geschieht – dem aber so langsam die Kraft ausging, die Kämpfe noch selbst und öffentlich zu führen.
Regine Möbius hat das Buch von 2009 kräftig überarbeitet und erweitert, sodass jetzt auch die letzten vier Jahre dabei sind, die das Porträt ergänzen und abrunden, einige der Debatten der Vorjahre neu gewichten. Aber gerade das macht noch deutlicher, dass Leipzig seither ein ähnlich wortmächtiger Streiter fehlt. Was auch am Verschwinden einer gemeinsamen Debatte liegt. Heute verzettelt sich auch Leipzigs Öffentlichkeit in viele kleine Öffentlichkeiten, wo jeder alles sagen darf und keiner mehr dem anderen zuhören muss. Das ist dann schon eine Meinungsfreiheit, die eigentlich gar keine mehr ist. Nur noch die menschgewordene Monade, ein Gewimmel vieler winziger Egoismen, die sich nicht mehr zu einem ernsthaften Streitgespräch zu treffen vermögen.
Ein Gedanke, der natürlich weit über das Buch hinauswirkt, aber dennoch viel mit Loests Wirksamkeit zu tun hat. Denn wirken konnte er auch deshalb, weil ihn selbst seine Gegner ernst nahmen. Seine Leser sowieso, denn sie fanden sich wieder in seinen Büchern. Loests Romane sind deshalb groß, weil er immer mit dem Herzen der kleinen Leute schrieb, dachte und wünschte. Und vielleicht verortet man seine „Löwenstadt“ wirklich am besten, wenn man in diese Welt der kleinen Leute geht, die keine Helden sind und eigentlich auch nicht mutig – und trotzdem auf liebenswerte Art widerständig, wenn sie sich dem Mitmachen und Jubeln verweigern.
Es ist eine ganz andere Zeitgeschichte, als man sie sonst assoziiert, wenn das Wort genannt wird: die Zeitgeschichte der kleinen Leute, für die ein Völkerschlachtdenkmal heimatlicher Fixpunkt und Zwiebelmuster auf dem Tisch ein kleiner Stolz sind auf das Selbsterreichte. Menschen, die eigentlich nur respektiert werden wollen für ihren Fleiß und ihre Arbeit.
Mittlerweile wurde auch schon zwei Mal der Erich-Loest-Preis an Schriftsteller verliehen, die ganz ähnlich mit dem Stoff der mitteldeutschen Geschichte gearbeitet haben. In diesem Band gewürdigt wird noch der erste Preisträger Guntram Vesper, der mit seinem Roman „Frohburg“ 2016 für Furore sorgte. Es gibt sie noch, die Autoren, die fähig sind, in der kleinen Welt die große zu sehen und in den Alltäglichkeiten den kleinen Mut, der die Welt verändern kann. Ein Mut, der aus Erich Loests Büchern atmet. Und wer ostdeutsche Geschichte begreifen will, wie sie kein Geschichtsbuch greifbar machen kann, der findet diesen Stoff bei Erich Loest. Oder sollte ihn dort suchen, damit die Debatten unserer Gegenwart wieder Inhalt bekommen.
Regine Möbius Schneisen der Zeitgeschichte, Mitteldeutscher Verlag, Halle 2019, 12 Euro.
Die neue Leipziger Zeitung Nr. 64: Kopf hoch oder „Stell dir vor, die Zukunft ist jetzt“
Die neue Leipziger Zeitung Nr. 64: Kopf hoch oder “Stell dir vor, die Zukunft ist jetzt”
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
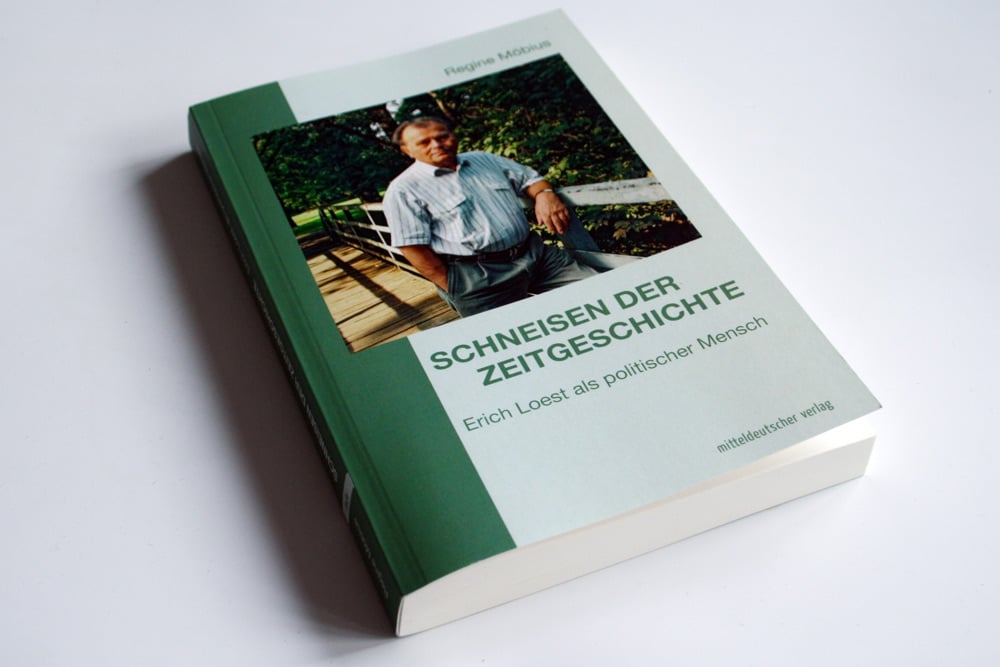










Keine Kommentare bisher