Vielleicht gibt es sie ja. Irgendwo versteckt in den Archiven der Bibliotheken: die Bücher über den Leipziger Widerstand im Nazi-Reich, Romane über all die Männer, die in Leipzig bis heute mit Straßennamen gewürdigt werden: Schumann, Engert, Kresse, Lehmann … Gehört hat man jedenfalls nichts davon. Und so ist auch Cornelia Lotters Buch „Schwarzer Mohn“ eine Premiere.
Ganz so, als hätten sich die Leipziger Autor/-innen der DDR-Zeit nicht an den Stoff getraut. Oder lieber die Finger davon gelassen, weil man damit die Erzählmuster der alleinseligmachenden Partei berührt hätte. Und da wurde es gefährlich, gerade wenn es um den kommunistischen Widerstand ging und seine Helden – und ihr Versagen.Denn die kommunistischen Kämpfer waren immer aufrecht, haben nie versagt und waren sowieso die einzigen, die gegen das NS-Regime Widerstand leisteten. Wer in der DDR an dieser Legende kratzte, bekam Probleme. So wurden dann auch die Geehrten zu Pappfiguren, irgendwelche in schlechten Reproduktionen überlieferten Gestalten, die so überhöht waren, dass man in ihnen den Menschen nicht mehr wahrnahm.
Die Dogmatisierung der DDR-Geburtslegende hat eigentlich sogar von Anfang an selbst dem Kern dessen, was man eigentlich würdigen wollte, alles Leben genommen. Man hat quasi seine eigenen Märtyrer postum noch einmal getötet und in triste 1.-Mai-Plakate verwandelt.
Und auch die Versuche von Bruno Apitz in seinen autobiografischen Büchern „Der Regenbogen“ (1976) und „Schwelbrand“ (1984) erzählen ja davon, wie die parteilich verordneten Tabus zur Darstellung der eigenen Widerstandsgeschichte dazu führten, dass ein Autor am eigenen Stoff scheitern musste. Das Nicht-Erzählbare entzog dem Noch-Erzählbaren alles Leben, alle Menschlichkeit.
Denn Menschlichkeit ist immer diffus. Dass es anders wäre, das behaupten nur die Legendenerzähler. Menschen sind nicht stahl-gehärtet, nicht einmal die mutigsten, deren größter Mut immer ist, menschlich zu handeln selbst da, wo darauf die Todesstrafe steht.
Es verblüfft schon, dass es die Zensoren im ZK der SED nie begriffen haben, bis zum Schluss nicht. Wobei: Wer Wolfgang Leonards „Die Revolution entlässt ihre Kinder“ gelesen hat, weiß, dass es darum nie ging und nie gehen durfte. Denn hinter diesem Du-sollst-nicht-Wissen steckte die alte Doktrin jener Ulbrichtschen Gruppe, die 1945 aus Moskau zurückkehrte, selbst zutiefst zerfressen von Angst und Verrat, die den in Deutschland gebliebenen Kommunisten und Sozialdemokraten, die tatsächlich Zuchthaus und KZ erlebt hatten, zutiefst misstraute.
Und das wird auch in Cornelia Lotters Buch deutlich. Denn die Gestapo-Protokolle, aus denen sie zitiert, stammen allesamt aus Akten des MfS. So nutzte der eine Geheimdienst die Geheimdienstlichen Akten der anderen Geheimpolizei dazu, gleich mal akribisch wieder belastendes Material gegen die Leute zu sammeln, die man offiziell feierte.
Und belastend sind die Gestapo-Protokolle schon deshalb, weil sie schwarz auf weiß belegen, dass eigentlich jeder Mensch in brutalen Verhören gebrochen werden kann, auch der mutigste und anständigste. Denn genau so funktionieren Diktaturen mit all ihren bereitwilligen Helfern: Sie wissen, wie man alles aus den Menschen herausprügeln kann.
Am Ende des Buches erzählt Cornelia Lotter kurz, was sie über diese Verhörmethoden erfahren hat. Denn das haben auch zwei ihrer Helden erlebt – Max und Karl Hauke. Wenn man weiß, wie sie gefoltert wurden, werden auch die Gestapo-Protokolle verständlicher, die sich alle so lesen, als hätte man die Verhafteten ganz zivilisiert nur polizeilich befragt und sie hätten sich dann ganz selbstverständlich korrigiert, ganz so, als hätten sie die Polizeibeamten vorher nur aus lauter Hinterlist beschwindelt. Da sind sich alle Geheimpolizeien gleich: Sie suggerieren sich selbst gern in den eigenen Protokollen, dass sie doch ganz normale, zivilisierte Polizeiarbeit gemacht haben.
Die Frage zur Aussagekraft der Protokolle stellt Cornelia Lotter auch, kann sie aber nicht beantworten, weil sich augenscheinlich auch die Forschung noch nie wirklich ernsthaft mit den falschen Schafsmasken der Geheimpolizei beschäftigt hat. Denn in dieser Frage steckt auch die Frage danach: Wie belastbar sind diese Niederschriften eigentlich? Wie viel davon ist erpresst, erzwungen, den Verhörten und Gefolterten in den Mund gelegt? Mit welchen Methoden wurde da eigentlich gearbeitet, um an Wissen zu kommen, das in den Händen der Macht weitere Menschen ans Messer liefert?
Misstrauen und Verrat
Und was sehen wir wirklich, was in diesem bürokratischen Verdächtigungsdeutsch formuliert wird? Denn eindeutig sind diese trockenen Texte, die Cornelia Lotter in ihren Roman eingestreut hat, schon Vorverurteilungen. Diese Protokollschreiber formulieren genau so, wie es der anschließend tagende Volksgerichtshof gern hatte: Die verhörten Menschen werden schon im Duktus der Protokolle zu Schwerstverbrechern gemacht. Und zwar so, dass es für sie nach Maßstäben des Nazi-Reiches nur die Todesstrafe geben kann.
Und umgebracht wurden gerade die Wehrlostesten sofort. Die Namen Nikolai Rumjanzew und Boris Losinskij sind den Leipzigern geläufig, denn nach den beiden sind in Leipzig Straßen benannt.
Eher stutzen werden sie beim Namen von Taissija Tongonog, die im Buch zumeist als Taja erscheint, eine junge Lehrerin aus der Ukraine, die als Zwangsarbeiterin zusammen mit ihrer Schwester Inessa nach Leipzig deportiert worden war und als Dolmetscherin in der Fabrik Karl Krause im Leipziger Osten arbeitete, denn als Deutschlehrerin beherrschte sie die deutsche Sprache perfekt, weshalb sie dann auch als Kontaktperson in verschiedenen Leipziger Fabriken, in denen Zwangsarbeiter eingesetzt waren, infrage kam.
Und über Nikolai Rumjanzew kam sie so auch in Kontakt mit Maximilian, Elsa und Karl Hauke, die aus ihrer kleinen Behausung in der Schrebergartensiedlung bei den Meyerschen Häusern in Kleinzschocher versuchten, Hilfe für die in der Nähe untergebrachten sowjetischen Kriegsgefangenen zu organisieren.
In einem kleinen Gespräch, das Cornelia Lotter in der nahe gelegenen Lebensmittelhandlung stattfinden lässt, versucht sie fast anekdotisch zu skizzieren, wie schnell ganz menschliche Hilfsbereitschaft in Angst umschlagen kann, wenn man selbst den Nachbarn im Ortsteil nicht mehr vertrauen kann und sogar der Vergleich mit christlichem Ethos gefährlich wird. Wobei ja genau das den Kommunismus einst attraktiv gemacht hat: die dem Christentum verwandten humanistischen Grundlagen, die dann im 20. Jahrhundert derart mit Stiefeln getreten wurden.
Natürlich hat auch Cornelia Lotter vor allem die trockenen biografischen Überlieferungen und die bedrückenden Gestapo-Protokolle zur Verfügung. Die menschliche Erinnerung konnte nur Karl Hauke noch vermitteln, der Sohn von Max Hauke, der als Vortragskünstler seit 1933 Auftrittsverbot hatte und sich und die kleine Familie nur mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser halten konnte. Karl Hauke starb 2016.
So sterben auch die Augenzeugen, die noch von all dem erzählen konnten, was in den Protokollen der Geheimpolizei niemals steht. Immerhin überlebten Max, Elsa und Karl – und das ebenfalls unter abenteuerlichsten Umständen, die selbst einen Roman wert wären. Denn ganz ähnlich wie Kurt Vonnegut, der später seinen weltberühmten Roman „Schlachthof 5 oder Der Kinderkreuzzug“ darüber schrieb, rettete auch Max Hauke der Bombenangriff in der Nacht vom 13. zum 14. Februar 1945 auf Dresden das Leben.
Taja freilich wurde von Nationalsozialisten in Auschwitz ermordet. Mit ihrem Tod endet eigentlich der Roman, der in seinen wesentlichen Teilen erzählt, wie es anfangs ganz selbstverständliche menschliche Hilfsbereitschaft war, die Max, Elsa und Karl dazu brachte, den unter unwürdigsten Bedingungen untergebrachten Kriegsgefangenen zu helfen, und wie daraus nach dem Auftauchen von Nikolai Rumjanzew nach und nach eine eigene Widerstandsgruppe wurde, die in Kontakt mit den anderen (linken) Widerstandsgruppen in Leipzig kam und irgendwann begann, eigene Flugblätter zu produzieren, die der Gruppe am Ende zum Verhängnis werden sollten.
Es liest sich anders, als wenn man es nur theoretisch in Geschichtsbüchern liest, wie sich dieser Widerstand versuchte zu organisieren in einem Umfeld, in dem das Misstrauen und der Verrat allgegenwärtig waren. Mit Spitzeln musste man immer rechnen. Das konnten selbst jene Genossen sein, die Verhaftung und Zuchthaus hinter sich hatten und von der Gestapo zu Zuträgern gemacht worden waren.
Märtyrergeschichten
Natürlich wirft Cornelia Lotter gerade mit dieser Konstellation die Frage auf, wie man selbst in solchen finsteren Regimen seine Menschenwürde bewahren kann. Und sage niemand, das sei ein Thema von gestern. Das passiert heute in viel zu vielen Staaten der Erde noch genau so, nach denselben Strickmustern des Verrats, der Rechtlosigkeit und der entfesselten Staatsgewalt.
Und aus einem durchaus nachvollziehbaren Grund geht Cornelia Lotter am Ende auch darauf ein, warum einige Märtyrergeschichten in der DDR immer wieder erzählt wurden, andere aber gar nicht. Man kennt zwar das Gedenken um die Gruppe von Nikolai Rumjanzew, aber welche Rolle die kleine Familie Hauke und deren Verbündete dabei spielten, das wurde eben nicht offiziell erzählt. Andere Geschichten der Widerständigkeit wurden vollkommen unterdrückt – und das betrifft nicht nur den bürgerlichen und christlichen Widerstand.
Der Hauptgrund wohl: Sie passten nicht ins heroische Schema, ins parteiliche schon gar nicht. Aber gerade weil Cornelia Lotter auf die menschliche Ebene geht und zeigt, wie ihre Held/-innen aus zutiefst menschlichen Motiven heraus handeln, macht sie auch sichtbar, was an den Heldenerzählungen der SED-Agitation alles fehlte. Wirklich fehlte. Und damit am Lebenskern der kleinen DDR. Denn die hatte sich ja quasi per Dekret von allen Altlasten befreit, den Faschismus für erledigt erklärt und alle ihre Bürger quasi mit Verordnung zu Antifaschisten gemacht.
Auf diese Weise musste man sich nicht mehr damit beschäftigen, was die NS-Diktatur eigentlich mit den Seelen der Menschen angerichtet hatte und warum so vieles im neuen Staat so seltsam den Mustern des NS-Reiches ähnelte. Denn das merkten augenscheinlich all diejenigen nicht mehr, die sich jetzt eifrig wieder zu Handlangern und Vollstreckungsbeamten machen ließen. Im Dienst einer „guten Sache“ ist ja jedes Mittel recht, oder?
Genau das ist die Frage, die mitschwingt. Was wäre eigentlich im Selbstverständnis dieses östlichen Teils Deutschlands anders gewesen, wenn man Geschichte eben nicht als heroischen Meistergesang verstanden hätte, sondern um ein immer wieder von Niederlagen geprägtes Ringen um mehr Menschlichkeit?
Ich formuliere es genau so, weil genau diese Selbsterkenntnis mit einem Tabu belegt war. Was dann selbst die Widerstandskämpfer, die zu Buchehren kamen, in etwas verwandelte, was mit den tatsächlichen Menschen mit all ihren Ängsten, Unsicherheiten, Eitelkeiten und Nöten nichts mehr zu tun hatte.
Mit solchen Helden kann man sich nicht identifizieren. Womit die DDR ja am Ende fast ohne Helden dastand. Ohne ein Vorbild, dem es sich wirklich nachzuleben lohnte. Und ohne ein Bewusstsein darum, wie schwer es ist, wirklich eine menschliche Gesellschaft aufzubauen, in der es kein Heldentum braucht, um Mensch bleiben zu können.
Die Folge ist dann tatsächlich, dass selbst die Geschichten derer, die tatsächlich Widerstand gegen das übermächtige Nazi-Regime organisierten, mit viel zu großer Verspätung endlich erzählbar werden. Mit über 70-jähriger Verspätung betritt man jetzt Elsas kleinen Garten mit dem Mohnblumenbeet, der der Familie wenigstens die Nahrung sicherte, geht mit Karl Kohlen „organisieren“, lernt auch den hilfsbereiten Arzt Fritz Gietzelt kennen und den von den Nazis gesuchten Maler Karl Krauße, der bei den Haukes kurzzeitig ein Obdach findet und nicht mit dem Fabrikanten Karl Krause verwechselt werden sollte.
Auch er hat die Nazi-Zeit zum Glück überlebt, war später Pressezeichner für die „Sächsische Volkszeitung“. Gerade diese Streiflichter aber zeigen, wie viel in Wirklichkeit im Erinnerungskanon der DDR unterdrückt wurde, wie blass und leer in Wirklichkeit die offizielle Geschichtserzählung war.
Selbst wenn die unpassenden Genossen dann in der frühen DDR selbst wieder herausragende Rollen spielten, wie der Genosse Hasso Grabner, dem Francis Nenik sein Buch „Reise durch ein tragikomisches Jahrhundert“ widmete.
Falsche Helden
Denn dass ein Mensch rein und klar und ungebrochen durchs 20. Jahrhundert spaziert ist, dürfte das unglaublichste aller Märchen sein. Und damit bin ich bei Brecht und seinem Gedicht „An die Nachgeborenen“, aus dem meist nur die blöde Zeile mit den Bäumen zitiert wird.
Natürlich auch, weil die meisten das Gedicht nie gelesen haben und auch nie verstanden, wovon dieser Brecht da eigentlich erzählt, und zwar schon in den 1930er Jahren, als er ehrlich genug war, seine eigene Schwäche zu erkennen in einer Welt, in der die Brutalität alles Menschliche niedertrampelte: „Ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut / In der wir untergegangen sind / Gedenkt / Wenn ihr von unseren Schwächen sprecht / Auch der finsteren Zeit / Der ihr entronnen seid.“
Das gilt bis heute. Gerade diese unerbittliche Menschlichkeit bei Brecht, der seine eigene Nicht-Heldenhaftigkeit nicht verleugnete und deswegen auch verstand, dass auch die später so gefeierten Helden genauso wenig heldenhaft waren, zerbrochen, von Scham und Schuld beladen, zum Widerruf gezwungen. Ohne Grund hat er seinen „Galileo Galilei“ nicht geschrieben.
Aber das durfte man in der DDR lieber nicht in den Klassenaufsatz schreiben. Und auch später erntete und erntet man dafür scheele Blicke. Hinterher waren immer alle heldenhaft. Und nie dabei gewesen. Geschichte aber wird nicht von Helden gemacht, sondern von Menschen, die den Mut haben, um ein kleines Stück Menschlichkeit zu kämpfen, auch dann, wenn die feigen Mächtigen darauf die drakonischsten Strafen gelegt haben.
Beantworten kann man das nur durch Geschichten, die von diesen ungewollt Tapferen erzählen.
Tipp: Am 27. August um 19 Uhr gibt e übrigens eine Live-Lesung von Cornelia Lotter aus ihrem Buch „Schwarzer Mohn“ bei Radio Blau.
Und „Schwarzer Mohn“ wird nicht das letzte Buch sein, in dem sich Cornelia Lotter mit den dunklen Seiten der Leipziger Geschichte im 20. Jahrhundert beschäftigt. Für das nächste – einen Torgau-Roman – hat sie jetzt ein Arbeitsstipendium der Stadt Leipzig erhalten. Und ihr Roman „Die Aufseherin“ (2020) wurde inzwischen auch für den diesjährigen Selfpublishing-Buchpreis nominiert.
Cornelia Lotter Schwarzer Mohn, Books on demand, Norderstedt 2020, 12,90 Euro.
Hinweis der Redaktion in eigener Sache
Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten alle Artikel der letzten Jahre auf L-IZ.de zu entdecken. Über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall.
Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.
Vielen Dank dafür.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
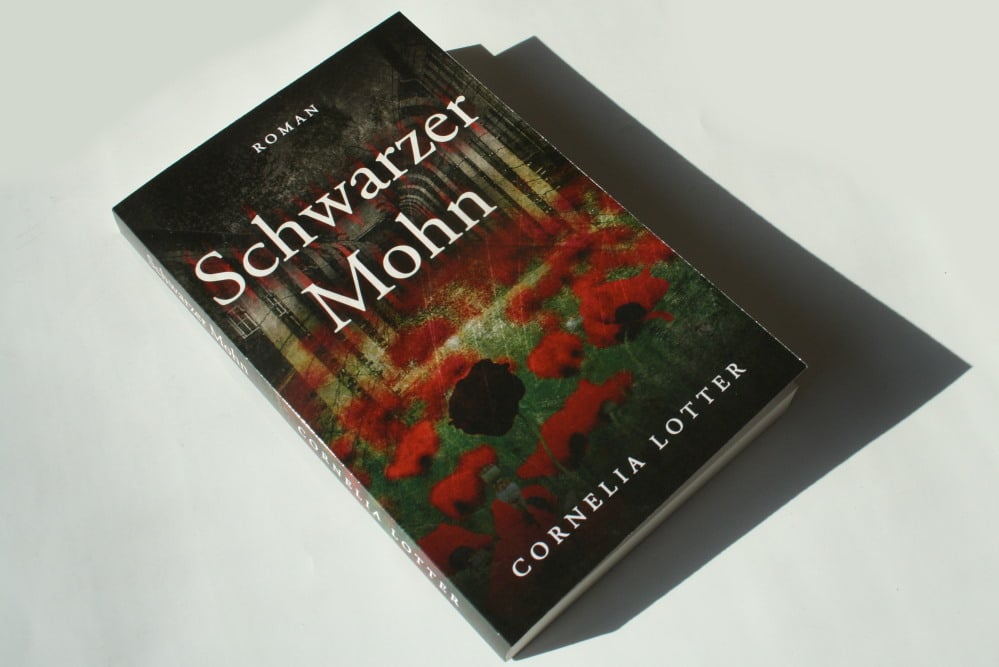






















Keine Kommentare bisher