Zensur hat viele Erscheinungsformen. Und manchmal scheinen die Leute, die so agieren, nicht einmal zu begreifen, dass sie es tun. So wie der amerikanische Verlag, der Elena Makarovas Buch über Friedl Dicker einfach nur deshalb ablehnte, weil er nicht in das Schema der dort produzierten Biografien passte: „Du bist nicht Nabokov, deine Literatur braucht hier keiner.“ Erschienen ist das Buch dann 2012 auf Russisch in Moskau. Und dann vergingen noch einmal zehn Jahre.
Bis der Roman nun in der lebendigen Übersetzung durch Christine Hengevoß im Mitteldeutschen Verlag auf Deutsch erschien. Zehn Jahre, die dem Roman seine Brisanz nicht genommen haben. Und auch nicht seine Schönheit.
Denn das hatten die Lektoren im amerikanischen Verlag schlicht nicht begriffen: Dass Elena Makarova hier etwas gelungen ist, was Autorinnen und Autoren biographischer Romane selten, sehr selten gelingt: Sie lässt die 1898 in Wien geborene Malerin, Designerin und Innenarchitektin Friedl Dicker lebendig werden, indem sie ihre Lebensgeschichte nicht nur aus der Ich-Perspektive erzählt, sondern aus der Rückschau ihrer Heldin, die sich an alles erinnert, an alles, was sie erlebt hat bis zu ihrem Tod 1944 in Auschwitz.
Und das in einem Ton, den man auch in Friedls Briefen an ihre Freundinnen findet. Mit diesen Briefen ist der Roman gespickt. Es sind die originalen Äußerungen der Frau, die die Nationalsozialisten in Auschwitz ermordeten, nur weil sie eine jüdische Herkunft hatte.
Da ist nichts zu kürzen
Ihre Bilder werden heute teuer gehandelt. Der amerikanische Verlag hätte mit einem „eleganten Coffee Table Katalog“ mit vielen ihrer Werke und Briefe einfach ein gutes Geschäft gemacht. Aber er wäre der Frau nicht gerecht geworden, die Elena Makarova mit einem liebevollen, verspielten, poetischen Stil lebendig werden lässt.
Im Vorwort schildert sie die Begegnungen mit den Menschen aus Friedl Dickers Leben, die sie in der Schweiz, in Israel, in Tschechien besucht hat. Wenn viele Menschen sich erinnern und erzählen, entsteht ein Bild, wird eine Heldin erst lebendig. Bekommt sie jene Facetten, die sie einzigartig machen, unverwechselbar.
Aber das zog nicht bei dem Verlag, dem das ins Englische übersetzte Manuskript zu dick war. „Cut them!“ So scheitern Arbeitsbeziehungen.
Dabei gibt es an dem Buch nichts zu kürzen. Man könnte die Briefe herausnehmen und in einem separaten Band verpacken. Dann bliebe immer noch eine einfühlsame Geschichte übrig. Eine, die zeigt, wie sehr die Geschichte Friedl Dickers der Autorin ans Herz gewachsen ist.
Wie sie sich ihr anverwandelt hat. Dann kann man irgendwann nicht anders erzählen als so – mit liebevollem Blick, Verständnis, leichter Trauer, viel Humor. Und das merken die Leser, wenn sie eintauchen in diese Geschichte eines Wiener Mädchens, das schon früh seine künstlerischen Talente entdeckt und dann zu den ersten Schülerinnen am neu gegründeten Bauhaus in Weimar gehört.
Die Geschichte berührt sich also gleich mal mit anderen Büchern, die wir hier besprochen haben. Bernd Sikoras „Spaziergang“ mit dem Bauhausdirektor Walter Gropius zum Beispiel oder Jörg Sobiellas „Weimar 1919“.
Die weibliche Seite des Bauhaus
Allein deswegen hat sie erzählt werden müssen. Denn Bauhaus hatte immer deutlich mehr Facetten als nur die Architektur. Und es wurde nicht nur von Männern geprägt, auch wenn fast immer nur die Männer im Mittelpunkt der Berichte stehen. Und meist wird auch vergessen, dass es ausstrahlte, dass es sich nicht nur auf Weimar und später Dessau beschränkte.
Dass die Schülerinnen und Schüler in die Welt hinausgingen und das Gelernte und Erfahrene umsetzten. So wie auch Friedl Dicker, die mit Franz Singer zusammen ein Atelier für Innenarchitektur betrieb. Und eine Liaison, wie es so schön heißt. Aber Kinder wollte er nicht von ihr und so musste sie bei jeder Schwangerschaft abtreiben.
Was Folgen hatte, denn dadurch waren ihr dann in ihrer Ehe mit ihrem Cousin Pavel Brandeis keine Kinder mehr vergönnt. Den heiratete sie, als sie aus dem zunehmend zum Faschismus tendierenden Österreich nach Prag emigriert war.
Oder geschickt von ihren Genossen, denn Mitglied der kommunistischen Partei war sie auch, obwohl das in Makarovas Erzählung nur am Rande mitschwingt. Auch wenn es ein Grund dafür ist, dass ihr die Emigration nicht gelang. Denn die Genossen hatten sie auch für Passfälschungen hinzugezogen – bis die Sache aufflog und Friedl mit den anderen verurteilt wurde.
Wahrscheinlich hat sie gerade deshalb die Ausreise nicht beantragt – auch aus Angst, von den Nazis sofort ins Konzentrationslager gesperrt zu werden. Und so erlebt man mit, wie sich die Schlinge langsam zuzieht um Friedl, wie ihr Leben nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht immer enger wird, das Ehepaar Wohnung um Wohnung verliert und sich zunehmend damit abfindet, dass es dem Abtransport „nach Polen“ nicht entgehen wird.
Auch wenn die erste Station erst einmal das Getto Theresienstadt ist, wo Friedl für viele der dort untergebrachten Kinder zu einem Halt wurde und einer Erinnerung fürs Leben.
Mut machen in Theresienstadt
Denn dort bot sie Mal- und Zeichenkurse für die Kinder an, ermutigte sie zum Malen und holte sie damit oft aus tiefster Niedergeschlagenheit heraus. Ein ganzer Koffer voller Kinderzeichnungen hat überdauert und erzählt von diesen zwei Jahren in Theresienstadt, bevor erst Pavel zum Transport nach Auschwitz befohlen wurde und Friedl ihm dann freiwillig folgte.
Nur dass Pavel überlebt hat. Wie Friedls Ende war, kann man nur vermuten. Das erzählt Elena Makarova nicht mehr. Es spielt auch keine Rolle. Denn es hat mit ihrem Leben und Fühlen nichts mehr zu tun. Und erst recht nicht mit ihrem eigensinnigen Blick auf die Welt. Mit ihrer Kunst schon gar nicht.
Es sind auch ihre Bilder, die es Elena Makarova möglich machen, Friedls Blickwinkel einzunehmen, ihre manchmal leicht ironische Sicht auf alles, was um sie herum geschah und ihr passierte. Als würden die Bilder auch ihren Stil prägen, wie sie ihr Leben im Nachhinein betrachtet. Voller Bescheidenheit.
Denn den großen Ruhm hat sie nie erlebt, auch wenn ihre Arbeiten immer begeisterte Käufer fanden. Wahrscheinlich bewahrt man sich auch nur so die Neugier auf alles und die spielerische Haltung im Leben, die selbst in den trübsten Fährnissen Hoffnung bewahrt und Zuversicht.
Das heißt: Diese Geschichte wird sehr persönlich. Hier urteilt eine Autorin nicht über die Heldin der Biografie, sondern versucht, ihr Leben auch aus ihren Augen zu sehen. So entsteht auch der leichte, fast abgeklärte Stil, der selbst dann nicht ins Melodramatische kippt, wenn es eigentlich kaum noch zu ertragen ist.
Die Gewohnheit Leben
„Das Leben ist eine Gewohnheit. Schwierig, es sich abzugewöhnen. Deshalb gibt es ja auch das Alter – es verwandelt das Leben in eine Last. Schwierig ist es nicht, sich vom Leben zu trennen, sondern von der Gewohnheit zu leben“, reflektiert die Erzählerin in einem der letzten Kapitel. Um dann so fortzufahren: „Ist es tröstlich, dass man nicht allein, sondern dass ein ganzes Volk von der Gewohnheit lassen soll?“
Da lässt sie die nächtliche Unruhe schon nicht mehr schlafen. Dass Friedl so oder so ähnlich dachte, machen die eingestreuten Briefe deutlich. Die auch eine Art Dialog der Künstlerin mit der Welt da draußen sind. Hier erzählt sie von ihren Gefühlen, aber auch ihren Natur-, Kunst- und Leseerlebnissen.
Was noch etwas anderes sichtbar macht, was beim Blick auf das Bauhaus und die Kunstströmungen der 1920er Jahre oft ausgeblendet ist: Wie hochgebildet und anspruchsvoll die Diskurse damals waren. Und damit auch die Frauen und Männer, die sich daran machten, eine neue Welt zu schaffen – neue Formensprachen in Kunst, Literatur, Architektur, Design.
Eine so fruchtbare Diskussion, von der wir noch heute zehren. Aber gleichzeitig viel komplexer, weil sie sich auch vor soziologischen und psychologischen Themen nicht verschlossen. Immerhin war Friedl Dicker auch Schülerin von Johannes Itten.
Leben in extremen Zeiten
Es wäre ein Frevel gewesen, Makarovas Erzählung auseinanderzureißen und eine Biografie nach dem üblichen Muster draus zu machen. Solche Biografien haben eine Logik, die das tatsächliche Leben nie hat, mit all seinen Irrungen und Wirrungen, der Liebe zu den falschen Menschen, geplatzten Träumen und dem alltäglichen Versuch, irgendwie Geld zu verdienen und festen Boden unter die Füße zu bekommen.
Und das in einer Welt, in der die Extremisten gerade die Stimmung anheizen und alles zu zerstören beginnen, was eben noch mutiger Aufbruch war.
Es war ja kein Zufall, dass das Bauhaus genau in der Stadt begann, in der auch die Weimarer Republik aus der Taufe gehoben wurde. Und dass es ebendort sofort zum Angriffsziel der Rückwärtsgewandten wurde. Und gerade weil wir scheinbar mit den Augen der Friedl Dicker schauen, die das alles hinter sich gelassen hat, wird sie lebendiger, als würde einfach nur ihre Lebensgeschichte anhand biografischer Daten erzählt.
So erlebt man aus der Nähe mit, wie sie versucht, die Kunst in ihrem Leben unterzubringen und im Malen jene Ruhe zu finden, die ihr hilft, auch die deprimierenden Zeiten durchzustehen und nicht zu verzweifeln.
Das geht nicht immer gut. Und wahrscheinlich war sie am Ende nicht immer so gelassen, wie Elena Makarova sie zeichnet. Aber sie muss für die Menschen, die mit ihr zu tun hatten, tatsächlich so etwas gewesen sein wie ein Ruhepol in einer von Ängsten erfüllten Welt, ermutigend einfach durch ihr Dasein und Agieren.
Das Böse ist nicht faszinierend, sondern nur schäbig
Während die Schergen, die die Vernichtungspläne der Nazis umsetzen, gesichtslose Gestalten am Rande bleiben. Sie bekommen nicht einmal die teuflische Größe, die sie in so vielen literarischen Werken über diese Zeit bekommen. Denn das Böse ist nicht groß. Das stellt auch diese Friedl Dicker immer wieder fest. Es ist schäbig, banal, feige und sinnentleert wie die Welten in Kafkas Romanen.
Kein Wunder, dass sich nicht nur Friedl mit diesem Herrn K. seelenverwandt fühlt. Sie erleben das Unfassbare ja auf ganz ähnliche Weise – zu Objekten degradiert und einem gesichtslosen Apparat gegenüber, dem der leidende Mensch völlig egal ist und die Amtswalter kein Gesicht haben. Der sich hinter Phrasen und Anordnungen versteckt und völlig gefühllos abarbeitet.
Das hat mit der Welt Friedls und ihrer Briefpartnerinnen nichts zu tun. Es drängt sich nur hinein, um die Menschen mit dem gelben Stern erst auszusortieren und dann zur Vernichtung zu sammeln. Die Distanz zwischen diesen Welten ist so gewaltig, dass es schlicht nur konsequent ist, Friedl ihr Leben selbst erzählen und kommentieren zu lassen. Ganz unsensationell, als wäre dieses Leben keine Sensation.
Und im Sinn heutiger Sensationsberichterstattung war es das auch nicht. Aber diese verfehlt ja die eigentlichen Sensationen sowieso, weil sie sich an die Menschen im Blitzlichtgewitter klammert. Während die still Schaffenden, die einfach aufgehen in ihrer Kunst, nicht mal eine Notiz wert sind. Vielleicht noch eine Standardbiografie.
Es sei denn, eine einfühlsame Autorin vertieft sich auf einmal in den Stoff eines ganzen Lebens und entdeckt die Faszination darin, die nicht nur mit den Namen Bauhaus, Itten, Kandinsky oder Klee beschrieben wird, sondern mit der verblüffenden Bescheidenheit, mit der Friedl Dicker ihre Bilderwelten schuf.
In denen natürlich ihr Blick auf die Welt steckt. Den man nachempfinden kann und der stimmig wird mit all den Briefen, die Friedl dann auch noch aus Theresienstadt schrieb, immer besorgt darum, die Briefpartner/-innen nicht zu frustrieren und ihnen das Bild einer Frau zu geben, die sich von den Widrigkeiten einer aus den Fugen geratenen Welt nicht entmutigen lässt.
Elena Makarova Friedl Mitteldeutscher Verlag, Halle 2022, 32 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
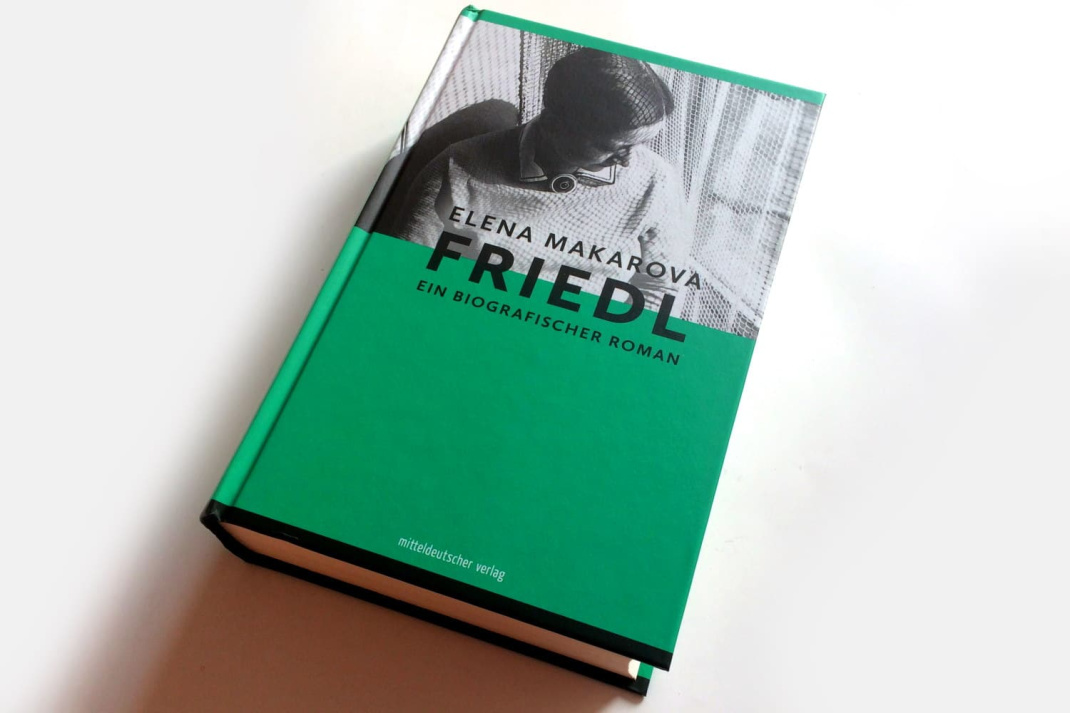




























Keine Kommentare bisher