Mit 60 Jahren denkt man anders über das Leben, denn da ist dann nicht mehr ganz so viel übrig davon. Da hat man das Meiste erlebt und auch gespürt, wie das ist, wenn man die wichtigsten Menschen, die einem Orientierung gaben, verliert. Da steht man dann ziemlich allein im Wind und es sind gegebenenfalls die Kinder und Enkel, die nun skeptisch auf einen schauen: Ist er weise geworden? Kann er uns was sagen über das richtige Leben? So ungefähr muss es Andreas Altmann gegangen sein.
Er gehört zu den begabtesten und vielfach ausgezeichneten Dichtern aus dem Osten, wurde in Hainichen in Sachsen 1963 geboren, lebt aber heute in Berlin und oft und gern auch in der Prignitz, einer jener verschollenen Landschaften der Mark Brandenburg, in denen der Lärm der Städte Welten weit entfernt ist. Wo man auf sich selbst zurückgeworfen ist und auf die Landschaft, wo man praktisch gar nicht anders kann, als die Welt da draußen vorm Fenster wahrzunehmen. Denn sie konfrontiert den Spaziergänger auf Schritt und Tritt mit seiner Vergänglichkeit. Auch, weil sie so ungeniert ihre eigene zeigt.
In der Prignitz ist man noch verbunden mit der sichtlichen Vergeblichkeit menschlichen Bemühens. Denn da auch hier die Menschen seit Jahren abwandern, werden Häuser um Häuser zu leeren Hüllen. Geisterhafte Orte, an denen die Natur wieder Fuß fasst. Oder: „scheiben sind mit tüchern verhangen / immer wieder sind abrissbagger zu sehen, die zu super / märkten gerufen werden …“
Vielleicht ist es auch ein Berlin-Gedicht: „das viertel“. In das die seltsamen Erlebnisse in der Corona-Zeit hineinschattieren: „einmal am tag ist ein laut / sprecherwagen zu hören, der vor Kontakten warnt …“
Gelb liegen die Wiesen
Da kann man tatsächlich gleich in die Prignitz fahren und sich auf die Wälder einlassen, die Beobachtungen der Kraniche, den Regen, die Wiesen: „gelb liegen die wiesen im geöffneten blick“, heißt es in „erbe“, ein Gedicht, in dem der Autor den Blick auf die – abwesenden – Kinder richtet. Nicht einmal seine eigenen. Denn wie verbittert die Menschen in dieser Einöde längst sind, weiß er ja: „am morgen warten sie auf züge, die nicht kommen. / dann gehen sie nach hause und schlagen ihre / kinder, damit sie härter werden als sie, und das leben / besser verstehen. Doch die kinder sind lange schon / fort …“
Der Dichter sieht, was Politiker nicht sehen wollen. Oder können. Wie sich Landschaften verändern, wenn die Menschen fortziehen und die Alten und Verbitterten allein zurückbleiben. Die dann in der Regel mit dieser still gewordenen Landschaft nichts anfangen können. Zurück bleiben leere Häuser, die sich zusehends in Ruinen verwandeln, in Rauch aufgehen. Eine geradezu irreale Landschaft, in der das Menschgemachte wieder verschmilzt mit der Natur. Die aber auch nicht mehr heil ist. Der Weiher trocknet aus, die Wiesen vergilben. Und am Wegrand liegen tote Tiere.
„ich sehe / menschen, denen ich begegnet bin. sie sind so / seltsam still. Und lächeln nicht“ („ergeben“)
Manche tigern auf dem Bahnsteig, an dem kein Zug hält, auf und ab. Doch der Dichter ist Beobachter. Ein nachdenklicher, denn die Vergänglichkeit hat ihn längst selbst eingeholt. Das Elternhaus ist zu einem leeren Haus geworden. Immer wieder kommt Andreas Altmann auf seine Eltern zu sprechen, von denen ihm eigentlich nur die Strenge und das Schweigen geblieben sind. Seine Bezugsperson zum eigenen Schaffen war eher sein Kunsterziehungslehrer aus Hainichen, den er bis zu dessen Tod immer wieder besuchte.
Die Kunst als Sprache für all das, was sonst nicht gesagt werden konnte. Nicht nur Gedichte. In diesem Band sind auch etliche von Altmanns Fabelhäusern abgebildet, die er – wie er schreibt – in einer Schreibpause zu basteln begann. Und die an seinen einstigen Lehrer genauso erinnern wie an seine eigene, poetische Anverwandlung der Welt.
Schneetiefe Spuren
Auch seinen Gedichten merkt man es an. Hier geht einer seinen Wurzeln nach, zieht eine Art Bilanz. Die „Hälfte des Lebens“ klingt an. Auch wenn es nicht um die Hälfte geht, sondern ums Ganze, um das, was bleibt. „mutter und vater / sind tot. Sie haben den garten nicht gesehen, in dem ich / neben dem kleinen feuer sitze und jeden abend bäume / verbrenne, die nicht in den himmel gewachsen sind“. („elternhaus“) Dem Elternhaus folgen noch weitere Häuser, die möglicherweise dort in der Prignitz stehen – mit offenen Türen, in denen sich die Spuren der Füchse verlieren. Die Vergänglichkeit ist überall präsent.
Und trotzdem bricht sie der scheinbar einsam Wandernde immer wieder auf, sagt sich selbst: „das leben ist schön“. Er weiß, dass er Beobachter ist. Und Beobachter sind einsam, so sieht es aus, erst recht, wenn sie das Gesehene einfach nur dokumentieren, wenn auch in starken, wie kalligrafisch gezeichneten Bildern. „die bäume sind schwarz / und haben das licht gesehen, als es schatten / von ihren stämmen zog. jeder schritt kennt nur / den vorangegangenen. Weiß nichts von ihm. / auf dem dach liegen die spuren schneetief. /ich schließe die tür / von beiden seiten der augen“. („das kalte haus“)
Doch was wie eine Bilanz aussieht eines Lebens, das sich jetzt in all seiner Vergänglichkeit zeigt, ist tatsächlich der Beginn einer Suche. Er hat die Orte ausgeschritten, ist von Bild zu Bild gegangen und hat sich der Stille ausgesetzt. „die stoppelfelder brennen im blauen licht. Eine mutter / kuh brüllt unaufhörlich. Das verfolgt mich, kommt / näher. Die nächte sind am schlimmsten, was bin ich / für ein mensch …“
Diese Frage stellt sich Altmann nicht nur in „vom himmel“. Sie umspannt das ganze letzte Kapitel, in dem er sich mit dem Alter und dem Altgewordensein beschäftigt. „mit den jahren gehe ich langsamer ein. / manchmal träume ich, dass ich wach bin. Dann / baue ich häuser, die auf eisernen beinen stehen. / ich hab eine frau, eine tochter und bin großvater. / das ist alles. Ach, mehr als die hälfte meines / lebens schreib ich gedichte, aber was heißt das schon.“ („resümee“)
Wer jetzt kein Haus hat
Es ist ein offenes Resümee. Man kann viele dieser Gedichte auch als stimmungsvolle Variationen des Hölderlin-Gedichtes lesen. Variationen, die nur möglich sind, wenn sich jemand so intensiv in sein Gewordensein vertieft und sich die Fragen zu stellen versucht, die am Ende wichtig sind. Denn was bleibt? Geht es darum, Bäume in den Himmel wachsen zu lassen? Oder doch nur darum, wirklich dagewesen zu sein und das Krabbeln auf Erden offenen Auges auch wirklich wahrgenommen zu haben?
So wie im letzten Gedicht im Buch – „tür aus“: „so schön ist es, dass ich nicht sterbe. wenn ich / die augen offen halte und weit genug schließe. / das leben ist schön. Immer höre ich es / in einem andern licht. Dann ist das lied gesungen / und beginnt noch einmal …“
Es ist ein eher verhaltenes Lied. Aber eines, das sie alle aufnimmt – die Fliegen, die Amseln, die Füchse, die Rehe und die Wölfe. Den hinkenden Kranich. Alles ist vergänglich. Und das Sterben da draußen lässt ihn nicht kalt. Doch er lässt es gelten. So wie die Dissonanzen, die durch menschliches Tun entstehen: „restblut ist am federkleid / verkrustet. ein kranich liegt im stoppelbrand, / mit gespreiztem schnabel. im weißen laub / stochert die amsel. Wer jetzt kein haus hat, / stirbt“.
Das klingt ernüchternd. Als wollte Andreas Altmann hier auch noch Rilke aus seinen hoffnungsvollen Höhen herunterholen. Doch es erzählt auch von einer völlig veränderten Sicht auf das Zuhausesein. Denn wo bei Rilke noch die goldene Ernte des Jahres zu lesen ist, zeigt Altmann eine geschundene Welt, die selbst im Sommer so abweisend scheint wie im Herbst und im Winter. Einsam sowieso. „bäume holen sich / den bahnhof zurück und fahren mit ihm fort. / ich habe über die jahre den zügen gewunken, / in denen ich saß …“ („wendepunkt“) Doch: „ich bin zu alt, um der kindheit ins auge zu sehen. / sie lächelt verlegen und geht ihren weg, / ohne nach vorn zu schauen.“
Wo ich gewesen bin …
Man merkt schon: Altmann hätte den Gedichtband mit Texten, die allesamt ein großes stilles Panorama mit starken, aber geradezu reduzierten Landschaftsaufnahmen bilden, auch „Hälfte des Lebens“ nennen können. Nur wenige Dichter lassen sich so intensiv auf diesen Wendepunkt ein, dieses Eingeständnis, dass die Welt jetzt eigentlich den Kindern gehört. Und dass er jetzt wohl so etwas Ähnliches erlebt wie seine Eltern dereinst. „ich sehe die dinge / vom ende her, hast du gesagt. Das ist ein langsamer satz / am bahnhof werde ich abgeholt. Ich bin fremd hier. / immer fühlte ich mich fremd, nur bei dir nicht“ („am morgen“)
Es klingt wie beiläufig hingeschrieben. Und erzählt doch von einem tief sitzenden Lebensgefühl. Und davon, wo wir uns tatsächlich heimisch und angenommen fühlen. Mit der erschütternden Erkenntnis dann, wenn wir selbst die Dinge vom Ende her sehen, dass sich das nicht wieder einholen lässt. Dass man nun auskommen muss damit, dass man am Bahnhof nicht mehr abgeholt wird. „auf dem rückweg komme ich / mir entgegen und frage mich, wo ich gewesen bin.“ („tür aus“)
So geht es einem, wenn man auf einmal zur Ruhe kommt und zurückschaut und merkt, dass das alles Leben gewesen ist. Von dem wir nicht wissen. Oder nicht mehr wissen, weil wir es vergessen haben. Oder übersehen. Da wird uns das eigene Leben auf einmal fremd. Wie will man da Bilanz ziehen? Oder ist es gar keine? Besichtigt hier dieser Dichter aus Sachsen, den es in die Stille der Prignitz verschlagen hat, nicht eher das Tableau seiner eigenen Gegenwart? Den Ort, der ihn – ob auf Waldwegen oder einer Wiese mit Gänseblümchen, denken lässt: „Das Leben ist schön.“
Ein Schweigen in Worte gebracht, wie er in „tür aus“ beschreibt: „am ende der blicke wohnt ein haus, / weitet die hellen felder, über die ich mit aus / gebreiteten armen laufe und dabei immer tiefer / in den schnee versinke.“
Das Kind in uns
Jedes Gedicht ein Bild, scheinbar abgeklärt, ernüchtert, als gelte es wirklich nur noch aufzuschreiben, was es alles noch gibt im augenblicklichen Panorama des eigenen Lebens. Und trotzdem ist es keine Schlussbilanz. Eher eine ganz unerhörte Begegnung mit sich selbst, so wie in „kleine schritte: „im rücken kommen / kleine schritte näher. Sie rufen, als wär ich gemeint. / es ist das kind, es will zu mir. Ich bin es, ich.“
Auch dieses Gedicht hätte Altmann ans Ende setzen können. Denn genau das passiert ihm ja, während er Gedicht für Gedicht danach fragt, was er eigentlich für ein Mensch ist. Eine Frage, die man mit Gedichten nicht beantworten kann. Nur mit Bildern. Und so begegnet er sich selbst. Dem Kind, das er ja trotzdem immer noch ist, neugierig auf alles, was da (noch) kommt. Wer nicht mehr neugierig ist und bereit, sich berühren zu lassen von allem, was einem begegnet, der ist dann wahrscheinlich schon tot. Den werden auch die Rufe der Kraniche nicht mehr wecken. „ich werde wach / und es ist tag. so einfach kann es sein.“ („einfach“)
Und gerade weil Andreas Altmann davon so überhaupt kein Aufsehen macht, merkt man, dass es hier die ganze Zeit um das Eigentliche geht. Das scheinbar so Simple, das Gewahrwerden, dass jeder Tag ein Geschenk ist, das wir annehmen können. So wie die ganzen Tage davor. Und unser So-Gewordensein. Ist das schlimm? Nicht wirklich, stellt Altmann in „herbst“ fest: „oft träume ich jetzt / vom schnee wie er fällt und fällt und ich durch / ihn gehe, rückwärts, um meine spuren zu sehen, / die mir voraus sind. Das leben ist so kurz.“
Aber was drin steckt in diesem kurzen Leben, das ist eine Besichtigung wert. Und sei es nur mit dem aufmerksamen Blick des Dichters, der nicht die Schönheit in der Welt sucht, sondern die Momente, in denen uns das Leben den Atem verschlägt und irgendwo ein listiger Hintergedanke im Kopf trocken feststellt: „Das Leben ist schön.“
Andreas Altmann „Von beiden Seiten der Tür“, Poetenladen, Leipzig 2023, 19,80 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
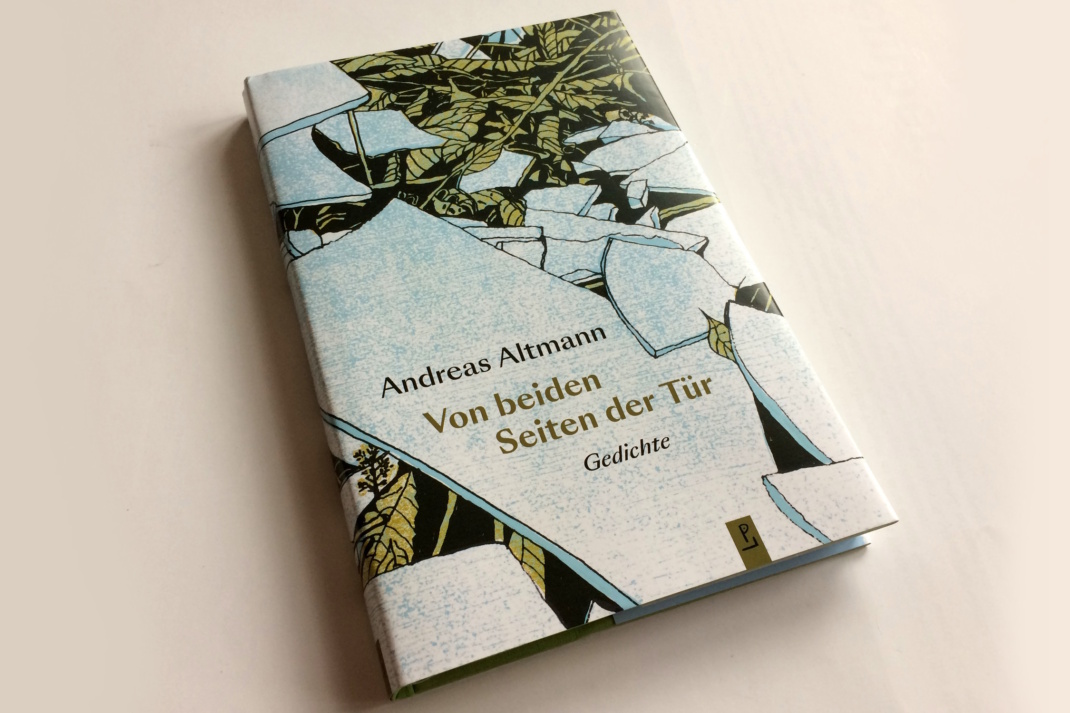






















Keine Kommentare bisher