Das ganze Leben ist Poesie. Das klingt jetzt etwas falsch, weil man bei Poesie nur an süßlichen Reimkram denkt. Dabei ist ein poetisches Verhältnis zum eigenen Leben genau der Stoff, aus dem unsere Träume sind. Manchmal auch unsere Albträume. Manche wissen gar nicht, dass sie derart dicht mit dem Leben verwoben sind. In „Tulpa“ gibt Andra Schwarz einen Eindruck davon, wie das ist. Natürlich verwirrend.
Denn wir erleben ja unser Leben nicht so schön eindeutig wie im Bilderbuch oder im Schulbuch. Wir verstricken uns in unseren Gefühlen, sind voller Ahnungen, Zweifel, Misstrauen. Selbst da, wo wir intensive Beziehungen mit anderen Menschen eingehen. Weshalb die Dichtung ursprünglich ganz und gar nichts für nette Kaffeekränzchen war, sondern Teil der religiösen Sicht der Menschen auf ihre Umwelt.
Voller Zaubersprüche, Beschwörungen. Magie. Es war die Welt der Geschichtenerzähler, Beschwörer, Schamanen. Manchmal spürt man diesen Ton noch bei den großen Dichterinnen und Dichtern.
Das menschliche Verhältnis zur Wirklichkeit
Und es steckt natürlich auch im Titel, den Andra Schwarz für ihren zweiten Gedichtband gewählt hat: „Tulpa“, in der „Theosophie eine Manifestation von Gedanken, die durch reine Willenskraft entsteht“, wie es Wikipedia erklärt.
Ob es denn auch theosophisch ist, müssen die Theosophen entscheiden. Magisch trifft es wohl eher, magisch in der ursprünglichen Beziehungen der Menschen zur Welt, zum Leben, zum Sein, zum Träumen. Wiederzufinden etwa in den Texten von Ingeborg Bachmann, Sylvia Plath und Kim Hyesoon, die Schwarz zitiert. Einige Zitate beziehen sich dann direkt auf die Fernsehserie „Twin Peaks“. Eine Serie, die mit übernatürlich-phantastischen Elementen spielt, die das Leben in einer idyllischen Kleinstadt immer verwirrender machen.
Und die damit natürlich all jene ansprechen, die dieses irritierende Verhältnis zur erlebten Wirklichkeit kennen. Für die dunkle Wälder, Eulen und Krähen immer auch etwas bedeuten. Etwas Unentzifferbares und dennoch Deutbares. Denn natürlich deuten wir uns die Welt immerfort. Und je mehr wir wahrnehmen, umso mehr davon kommt auch in unseren Träumen vor, auch in den Wachträumen.
Die Magie des Lebendigen
Zumindest dann, wenn wir es zulassen und uns nicht hinter lauter durchgeplanter Geschäftigkeit verstecken. Deshalb muten die Gedichte von Andra Schwarz wie magische Beschreibungen ihres Lebens an. So wie man es erlebt, wenn man fiebernd im Bett liegt zwischen Traum und Wachsein: „Ich warte unerkannt im Dunkeln, im Bett mit Fieber, Gliederschmerzen. / Brauche einen Pool von Kröten, Schwesterntiere, zarte Spritzen oder Hirten …“
Wenn man – fiebernd – die Pfade des alltäglichen Denkens verlässt, taucht man in Assoziationen ein, merkt man auch wieder, wie animalisch und deshalb gefährdet unser Leben ist. Da macht nicht nur der Körper Scherereien, sondern auch der Kopf. „Ich liege da, wo unsere Köpfe siedeln: In Träumen von Süden am Flussufer / zwischen Krokodilen. Bekomme Panik, verwandle sie in flüchtende Schwärme. / Spatzen am Horizont …“
Traum mischt sich mit Eindrücken der Wirklichkeit. Die Schwärme von Spatzen können durchaus real sein. Und dennoch zum Traumbild werden. Bedeutung gewinnen. Denn selbst in ihrem zwitschernden Dasein in der Stadt erinnern sie uns daran, dass wir eigentlich noch immer Teil der Natur sind, auch wenn wir so tun, als könnten wir auf die lebendige Welt verzichten. Aber das können wir nicht. Wir stecken fest zwischen Geburt und Tod, sind verletzlich und angreifbar.
Und gerade die Frau spürt es. Andra Schwarz widmet diesem Frau-Sein ein ganzes Kapitel, betitelt mit „Alb“: „Die Unfähigkeit zur Freude an reinweißen Blüten, / nur bluten soll sie in wiederkehrenden Zyklen. / Das Gefäß, das sich füllt und füllt, und dann überließt.“
Illusion von Kontrolle: Leben ist nicht „cool“
Natürlich sind das alles Texte aus der Tiefe des Ichs – auch mit formulierter Sprachlosigkeit, Einsamkeit, hochempfindlich. Also weit weg vom „coolen“ Drüberstehen, als wäre das Leben beherrschbar und sortierbar. Und nicht in Wirklichkeit unberechenbar. Und wir sind oft ganz und gar nicht Herrin oder Herr unseres Schicksals.
Fast zwangsläufig gibt es dann auch ein ganzes Kapitel „Moira“. Denn natürlich können wir so tun, als hätten wir alles in der Hand. Das, was uns unser Gehirn dann aber erzählt, wenn wir es nicht mehr auf die täglichen Erfolge fokussieren, erzählt von etwas anderem: „Im Traum kehrt sie zu mir zurück, offenbart mehrere Wege: / Ein Weg führt in die Wildnis hinter dem großen Teich, / Fremde (Eine noch zu bestimmende Größe). / Ein anderer richtungslos versinkt im Nebel …“
Man spürt, wie sie dem Unsagbaren und Traumhaften nachspürt, das unser Leben immerfort mit einem doppelten Boden versieht. Mit Unsicherheiten. „Wie kann ich die Fäden lösen, in die es mich verstrickt?“, beginnt ein Gedicht aus diesem Zyklus. Ein anderes: „Als ich um die Ecke biege, weiß ich nicht wo ich bin. / Der Faden lenkt mich durch ein Labyrinth …“
Man kann die Texte als reine (Alb-)Traum-Gedichte lesen. Aber auch als magisches Beschwören jener Intensität, die wir im Leben meist erst spüren, wenn wir auch unseren verwirrenden Gefühlen Raum geben, der Unruhe, die uns an unsere Körper fesselt und uns eigentlich immerfort auch unsicher sein lässt, ob wir wirklich dem eigenen Lebensfaden folgen.
Oder uns ganz gewaltig verirrt haben, weil wir uns selbst nicht trauen oder getraut haben. Oder im anderen etwas sehen, was uns ängstigt, stört, verwirrt. Partnerschaft ist eben doch nicht das ganze billige Herz-Schmerz-Gedöns aus der „Poesie“, sondern oft genug Verstörung, Ungewissheit und Schweigen, das sich dann mit Bildern und Vermutungen füllt. Möglich, dass davon in vielen Gedichten die Rede ist, auch wenn Andra Schwarz so konkret nie wird.
Ein dickes Fell gegen die Schafskälte
Was auch wieder nur konsequent ist. Denn wie will man den Anderen einfangen und deuten, wenn einen schon die eigenen Unsicherheiten plagen? Und Gefühle, natürlich, diese verflixten Dinger, die alles immer so kompliziert machen: „In seinen augen ängstliche kaninchen ungezähmt / ihr fauchen wenn ich ihm zu nahe komme / er sich plötzlich wegdreht von mir / da ist etwas, was ich nicht verstehe …“
So konkret wird sie selten. Aber es ist in so ziemlich allen Texten da. Da werden wir zum „gefährdeten tier“, in die Enge getrieben oder sprachlos vor Angst, dass die dicke Schutzhülle etwas preis geben könnte. Und dabei sind wir doch wie Schafe: „seine art braucht jegliche wärme / ein dickes fell in der schafskälte / eine herde einen platz für den winter …“
Nehmen wir ruhig an, es ist, was es ist. Dann ist auch das ein weiblicher Blick auf männliche Verletzlichkeit. Die Mann lieber versteckt. Wer wird denn über Gefühle reden, wenn man sonst „ohne schutz in tiefere wälder“ geht – und dann nicht wieder herausfindet? Verflixte Gefühle. Am Ende in „wenn es dunkel wird“ genauso wie am Anfang in „Elephant in the room“: „Er kommt mir nach, steht auf einem Minenfeld im Gras / und ich haarscharf daneben,
zähle Halme zwischen den Zehen. / Es ist zum Niederknien: sein einsames Trompeten in der Wildnis …“
Oder sollte man das so doppeldeutig nicht lesen? Oder doch gerade deshalb? Gerade deshalb als verflixte, magische Beziehungskiste, in der sich bald alle beide wie verwunschen und verbrannt fühlen: „… und ich, ach so schwarz, / sitze zwischen Heerscharen an Krähen vor einem Tümpel: / Finsternis im Herrgottswinkel, drin verschwommen sein Gesicht.“
Ungesagtes und Unsagbares
Aber so sind diese Begegnungen ja viel zu oft. Gerade, wenn es zwei ernst meinen und sich einlassen aufeinander. Und auf das permanente Reden und Deuten, aus dem Partnerschaft ja erst wird. Manchmal zu viel von allem. Oder zu wenig. Und immer ein Berg aus Ungesagtem. Und Unsagbarem. Das sich dann in solchen Bildern ballt. Zu viel hineininterpretiert? Keine Ahnung.
Denn diese Gedichte sind Einladungen, sich genau mit diesem Undeutbaren im Wahrnehmen unseres Lebens zu beschäftigen. Es auch zuzulassen, auch wenn es am Ende nur Gefühle sind. Die magische Verunsicherung eines Wesens in einer Welt, von der es spürt, dass es dazu gehört, nur nicht weiß, wie.
Und das betrifft dann wohl auch alle unsere verzwickten Beziehungen zu unseren Eltern. Dem Vater in diesem Fall, der im Zyklus „Three people had seen him, but not his body“ auftaucht.
Wie sehr Poesie unser magisches Verhältnis zur Welt erfassen kann, dem spüren vor allem die Texte im Zyklus „The owls are not what they seem“ nach: „Brauche Krafttiere, Federn und Felle,/ einen Schamanen in leuchtenden Farben, / einen Glücksritter auf eilendem Rappen.“ Da spricht die Dichterin dann auch mit den Tieren. „In der Nacht queren sie deine Angst.“
Und da ahnt man so ein wenig, wie magisch unsere Vorfahren ihre Welt empfunden haben müssen. Das ist eigentlich alles noch da, auch wenn wir längst einen veritablen Krieg gegen alles Lebendige führen und uns hinter Machbarkeitswahn und Technologiegläubigkeit verstecken. Nicht nur im Unterleib bleiben wir weiterhin verstrickt ins Lebendigsein. Und an der Grenze zwischen Wachsein und Schlaf meldet es sich zu Wort und erinnert uns auch daran, dass wir ganz und gar nicht alles beherrschen und nur das wenigste wirklich in der Hand haben. Aber wer nimmt schon Eulen, Krähen und Spatzen als Mahnung wahr?
Vielleicht all jene, die die tatsächliche Poesie in der Welt noch sehen und spüren. Die viel näher an unseren Träumen und Albträumen ist als an den zartbespitzten Poesiealben aus dem Herz-Schmerz-Regal.
Andra Schwarz „Tulpa“, Poetenladen, Leipzig 2023, 19,80 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
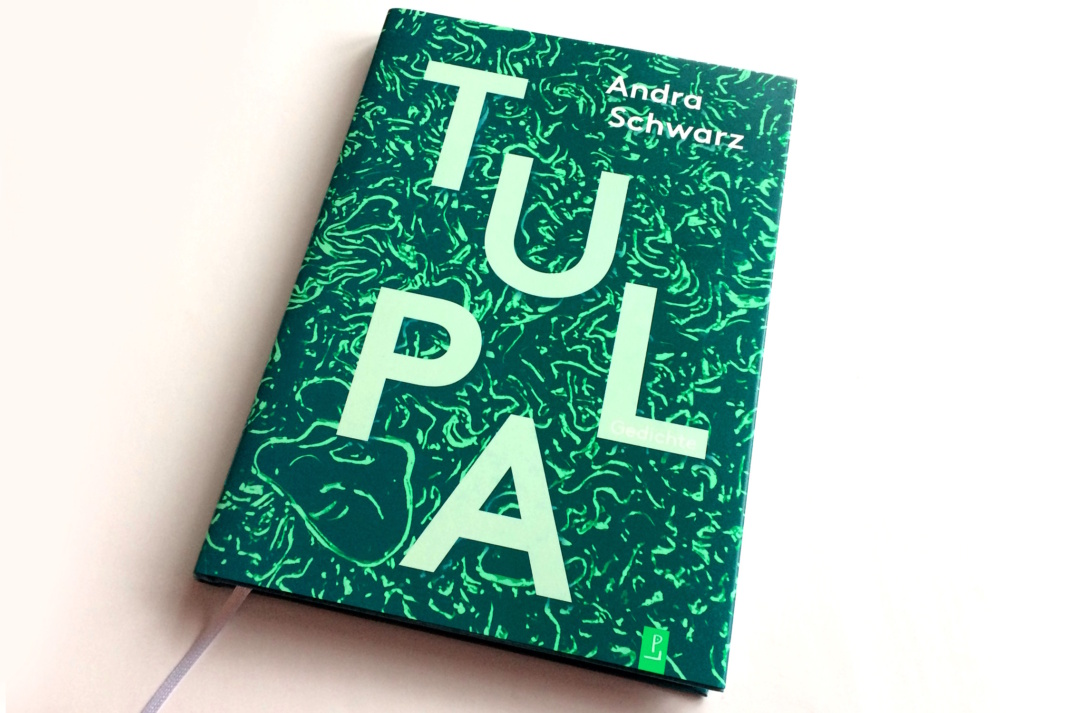

























Keine Kommentare bisher