Jetzt schreiben die Jüngeren, die noch jung waren, als die DDR in die Knie ging und von denen man annimmt, sie wären ja nicht so betroffen gewesen. Ihnen stand 1990 die Welt offen, sie wuchsen hinein in die neue Demokratie, das Land, in dem jetzt – angeblich nach Willy Brandt – „zusammenwuchs, was zusammengehörte“. Aber das ist bis heute nicht passiert. Was auch an den vielen nicht erzählten Geschichten liegt. Und dem fehlenden Verständnis füreinander. Nun hat auch Mayjia Gille ihr „Jugendbuch“ geschrieben.
Ein Buch, dem der Verlag vorsichtshalber die Erläuterung mitgegeben hat, es sei „auf Grundlage autofiktionaler Erlebnisse und authentischer Akteneinträge der DDR-Staatssicherheit“ entstanden. Aber wie fiktiv kann ein Roman sein, in dem die Wucht des eigenen Lebens derart zum Tragen kommt? Eines Lebens, das doch sehr an das Leben der Autorin erinnert, die jener selbstbewussten Magdalena ähnelt, die da im Jahr 1986 als Zwölfjährige die Reise in den Westen antritt, nachdem der dritte Ausreiseantrag ihrer Mutter endlich genehmigt wurde.
Ein Leben im Osten
Magdalena selbst ist Tochter eines berühmten Malers im Osten, doch selbst ihre Zeugung war schon der Versuch, eine Partnerschaft zu kitten, die nicht mehr zu kitten war. Und wirklich verschwunden ist ihr Vater aus ihrem Leben auch nicht. Bei seiner neuen Familie auf dem idyllischen Barnhof verlebt Magdalena die schönsten Tage ihrer Kindheit, während ihre Mutter zunehmend heillose Erfahrungen mit den Männern macht. Dabei war sie einst voller Hoffnung aus dem Westen in die DDR gekommen, um hier an der Theaterhochschule in Berlin Schauspielerin zu werden.
Doch die Machthaber in diesem Musterland des Sozialismus zeigten auch ihr schnell, wo im Arbeiter-und-Bauern-Staat der Hammer hängt. Sie bekam keine Zuzugsgenehmigung nach Berlin und auch kein Studium gewährt. Erst einmal sollte sie sich als Sekretärin in der sozialistischen Produktion bewähren. Man bekommt schon so ein Gefühl dafür, wie viel Frust sich im Leben von Magdalenas Mutter aufgebaut haben muss, die am Ende fast so etwas wie ihren Traumjob im Leipziger Bildermuseum gefunden hat. Und auch den hat man ihr genommen. Sie wurde ins Museum für Kunsthandwerk versetzt. Und erst ein später von Magdalena eingesehener Akteneintrag der Stasi verrät, wer da die Drähte gezogen hat.
Und die Stasi-Berichte sind nicht grundlos mit ins Buch gestreut, denn sie erzählen den anderen Teil der Geschichte, den die kleine Familie immer nur ahnen konnte, als sie noch in Leipzig lebte. Selbstbewusstsein und Widerspruchsgeist, wie ihn Magdalenas Mutter immer wieder zeigte, machten Menschen in diesem gut bewachten Staat fast automatisch zu Beobachtungsobjekten der Staatssicherheit. Und das Beklemmende ist eigentlich, wie Magdalena am Ende entdeckt, wie dicht das System der Zuträger rund um die kleine Familie war.
Heimatlos im Westen
Die Ausreise in den Westen erscheint da wie die einzig mögliche Lösung, auch wenn Magdalena ungern geht, denn gerade hat sie die ersten Gefühle der Liebe entdeckt. In Leipzig hatte sie Musik- und Ballettunterricht, war längst auf dem Weg, ihre künstlerischen Talente zu entfalten. All das fällt weg nach der Ankunft in Frankfurt, wohin Magdalenas Mutter mit ihr gereist ist, weil ihr eine alte Bekanntschaft die Heirat versprochen hat. Aber es dauert nicht lange, da merken beide, dass von dem Versprechen nichts zu halten ist, dass sie eher in eine seltsame anthroposophische Welt zu geraten drohen, mit der sie nichts zu tun haben wollen.
Und so werden die Jahre im Westen Jahre der Wurzellosigkeit, der immer neuen Umzüge und für Magdalena der immer neuen Bekanntschaften an Schulen, an denen sie sich immer weniger einleben kann. Die letzten Schulerfahrungen dann in Westberlin werden dann im Grunde schon Bekanntschaften mit einem völlig aus den Fugen geratenen bundesdeutschen Bildungssystem, dessen irritierende Folgen sich heute in immer deutlicherer Schärfe zeigen. Aber so richtig heimisch wird Magdalena nicht, neigt eher zum Schulverweigern.
Und man merkt, dass die ganze unsichere Situation sie auch psychisch mitnimmt. Ihre Mutter, die mit ihren eigenen Dämonen zu kämpfen hat, ist ihr nicht wirklich eine Stütze dabei.
Es ist mal kein Roman mit der Märchengeschiche, dass alles gut wurde, wenn Menschen nur den Weg in den Westen schafften. Tatsächlich erzählt er davon, dass man seine eigene Geschichte niemals zurücklassen kann. Dass man dabei sogar die Orientierung verlieren kann, weil der neue Ort kein Platz zum Verweilen ist. In ihrem Tagebuch sucht Magdalena immer wieder Halt und Ruhepunkte.
Doch nicht in den persönlichen Aufzeichnungen über Freundinnen und Alltag, sondern in den Wettermeldungen, die sie einst beim Mithören am Radio aufgeschrieben hat – Botschaften aus dem nächtlichen Äther, die von Wellen und Wind erzählten an sagenhaften Orten wie Kattegat, Bodden und Belt. Meterhohe Wellen. Drehende Winde. Unerreichbare Orte, wenn man als Mädchen in Leipzig aufwuchs.
Die Schatten der Vergangenheit
Doch auch im Westen gibt ihr das Tagebuch immer wieder Halt. Es beruhigt sie, wenn sie in heimatlosen Stunden das Tagebuch aufschlagen kann und in Gedanken zu den Seeleuten da draußen auf dem Meer aufbricht. Denn ihr Leben selbst wirkt auch eher wie ein treibendes Boot im Sturm. Was auch mit ihrer Mutter zu tun hat, die unverhofft den nächsten Umzug in die Wege leitet.
Als gäbe es keinen sicheren Ort, keine Ruhe. Und am Ende verdichtet sich die Mutter-Tochter-Beziehung zu einem handfesten Konflikt, der beinahe handgreiflich endet. Tagelang versucht Magdalena, eine Heimkehr in die gemeinsame Wohnung zu vermeiden, sucht lieber bei ihren Freunden aus Kreuzberg Nähe und Unterschlupf. Eine Situation, in der Eltern für gewöhnlich panisch werden.
Und vielleicht ist diese Lebensphase für die Autorin nur zu präsent, weil alle diese heillosen Gefühle nicht verschwunden und nicht vergessen sind. Auch nicht das Gefühl, dass das Leben gründlich daneben gehen kann, wenn man keinen Ausweg findet. Und das Verblüffende ist, dass ausgerechnet der Mauerfall dieser Ausweg zu sein scheint. Auch wenn die beiden selbst mit einem gewissen Befremden auf die nun über Westberlin herfallenden Menschen aus dem Osten schauen. Zu denen sie auch einmal gehörten.
Doch sie haben ihnen die Erfahrung im fremden Land voraus. Und die Begegnung mit den finsteren Seiten dieses Ostens, den heute manche wieder zu verklären versuchen. Doch nicht nur Magdalenas Mutter leidet unter den alten Erfahrungen. Auch Magdalena leidet unter einem durchaus beängstigenden Verfolgungswahn, der – wie man ja durch die Stasi-Protokolle weiß – tatsächlich Ursachen hat. Und Folgen, welche die Autorin, Schauspielerin, Sprecherin, Theaterpädagogin, Musikerin, Malerin, Moderatorin und Dozentin Mayjia Gille sehr wohl zu beschreiben weiß.
Denn wer sich immerzu beobachtet, kontrolliert und verfolgt fühlt, der schaut irgendwann falsch herum in die Welt. Der sieht die Handlungshoheit immer bei den anderen, die sich qua ihrer Funktion als Wächter anmaßen zu bestimmen, was die geltende Norm ist und wer dabei als „zuverlässig“ betrachtet wird und wer als „abtrünnig“.
Akzeptanz und Freiheit
Da können zwei wie Magdalena und ihre Mutter dem undurchsichtigen System zwar entkommen, gnädig beim dritten Versuch entlassen. Aber das, was diese falsche staatliche Moral angerichtet hat, werden sie nicht wirklich los. Es sitzt ihnen wie ein Alb im Nacken, geistert durch ihre Träume, schürt ihre Ängste. Bis Magdalena am Ende zu einem Pfarrer geht, der ihr tatsächlich das Gefühl gibt, dass sie angenommen ist, ein ganzer, lebendiger Mensch, der so, wie er ist, akzeptiert wird.
Und auf einmal kann sie wieder Farben und Details sehen, ist erlöst, als hätte der Pfarrer mit seinen einfühlsamen Worten tatsächlich eine Absolution ausgesprochen. Aber eigentlich ist etwas anderes passiert. Denn Magdalena musste ja nicht von Sünden freigesprochen werden. Aber die Last, die sie die ganze Zeit spürte, wurde ihr von de Schultern genommen.
Eine Last, die noch viel mehr mit dem Schicksal ihre Mutter zu tun hat, als sie ahnt. Denn mit herrschsüchtigen und manipulativen Menschen hat sie es nicht erst in der DDR zu tun bekommen. Die gab es auch in der Kindheit gleich nach dem Krieg, als das Mädchen zur Pflege in einen bayerischen Bauernhof gegeben wurde und dort Schikane und Entmündigunng erlebte. Auf einmal atmet die ganze dunkle Geschichte des 20. Jahrhunderts durch diesen Roman, das beklemmende und wohl auch stimmige Gefühl, wie sich die Erfahrungen der Eltern auch auf die Kinder fortpflanzen.
Unausgesprochen, was wohl alles nur noch schlimmer machte. Auch im Schweigen werden Botschaften weitergegeben. Die verinnerlichten Ängste der Mutter spielen auch ins Leben der Kinder hinein, die oft nicht wissen, woher ihre eigenen Ängste und Unsicherheiten eigentlich kommen. Genau so, wie es Magdalena geht, die Wesentliches über ihre eigene Mutter auch erst erfährt, als eine ihrer heftigen Begegnungen damit endet, dass die Mutter auch von ihrer Kindheit im bigotten Bayern erzählt.
Nicht mehr weglaufen
Die dunklen Erfahrungen überlagern sich. Und nach und nach erzählt Magdalena auch deutlich, dass sie es in großen Gruppen eigentlich nicht aushält. Als sie im Kindergarten war, wurde sie gar als „gruppen-inkompatibel“ bezeichnet. „Die Gruppe machte mir schon immer Angst.“
Das darf man dann wohl eine herzliche Erinnerung an die DDR nennen, mit ihrem Druck auf jeden Einzelnen, unbedingt dazugehören zu müssen. Wer nicht dazugehört und sich absondert – gerät in gefährliches Fahrwasser. Wird misstrauisch beäugt. Das sitzt tief. Und es macht vor allem jenen zu schaffen, die ihren eigenen Kopf haben und – wie Magdalena – den unbedingten Wunsch, kreativ sein zu wollen.
Am Ende setzt sie sich an ihrem Geburtstag in den Zug und fährt quer durch diesen verstörenden Osten zurück nach Leipzig. Mit dem Gefühl im Magen, ihre Mutter (wieder einmal) im Stich gelassen zu haben. Und trotzdem neugierig auf die, die zurückgeblieben sind und sie nun am Bahnsteig erwarten. Ihr Magen rumort. Und kurz ist der Impuls wieder da, einfach wegzulaufen.
Aber das kann man nicht dauerhaft machen, wenn man leben will. Auch das steckt in dieser Geschichte. Man muss sich der Vergangenheit stellen. Schon deshalb, um das Gefühl zu entkräften, dass man in dieser Welt nicht genügt und irgendwelche anderen Leute über das eigene Leben bestimmen. Die Begegnungen mögen schwierig sein, aber wo sonst sollte man erfahren, wer man wirklich ist? Und dass man trotz allem genau so akzeptiert wird, wie man ist? Oder besser: gerade deshalb. Weil man einzig und unersetzlich ist.
Erstaunlich, aber da steckt ein ganzes Stück ostdeutscher Nicht-Begegnung und Flucht drin. Die möglicherweise einiges von dem erklären, was heute für so viel Lärm und Unmut sorgt. Als hätten die Leute sich alle irgendwo in der Vergangenheit verloren und würden sich in der Gegenwart nicht wiederfinden.
Anders als Magdalena, die eigentlich mit ihrer Rückkehr beginnt, nicht nur ihr Leben in die eigenen Hände zu nehmen, sondern die sich auch ihrer Geschichee stellt – ihre eigenen und der ihrer Familie: „Einen kurzen Augenblick will ich wegrennen. Aber es ist meine Familie. Sie sehen alle so unverändert aus. Als wären sie nie von hier fortgegangen.“
Aber die Zeit des Wegrennens ist vorbei. Wer immer nur wegrennt, findet nie zu sich selbst und zu den Wurzeln, die ihn mit dem Leben verbinden.
Mayjia Gille „Landgang“, kul-ja publishing, Erfurt 2023, 25 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
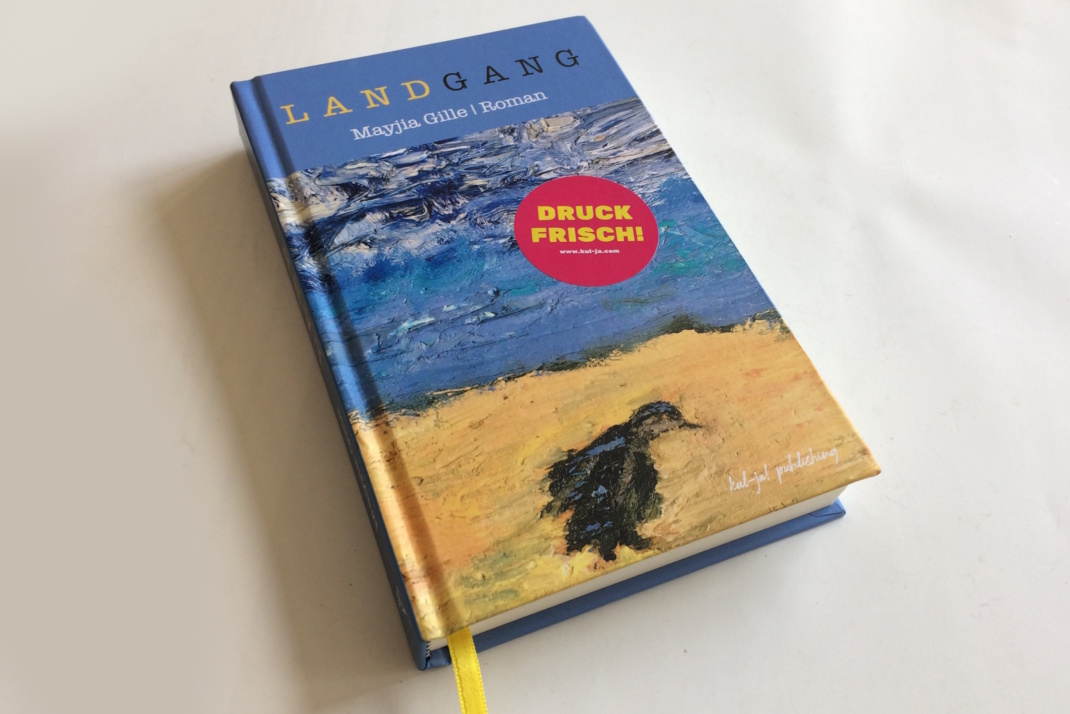























Keine Kommentare bisher
Danke für die Rezension, das Buch werde ich mir beschaffen. Klingt alles sehr interessant, und die Autorin ist, wenn ich mir das erlauben darf, eine faszinierende Frau.