Wuchs da eigentlich zusammen, was gar nicht zusammengehörte? Waren die Ostdeutschen blutige Anfänger in Sachen Demokratie und haben es bis heute nicht geschnallt? Hat aber auch Dirk Oschmann nicht recht, der die Ostdeutschen für eine westdeutsche Erfindung hält? – Alles Fragen, die Christina Morina streift bei ihrem Versuch, die deutsch-deutschen Unpässlichkeiten besser zu verstehen.
Am Ende geht es auch um Angela Merkel als Kanzlerin aus dem Osten und um die AfD, die einst von westdeutschen Professoren gegründet wurde, aber im Osten ihr großes Experimentierfeld in Sachen Pöbelpolitik gefunden hat und damit scheinbar auf einen fruchtbaren Boden traf. Wobei ja die Mutmaßungen, welcher Humus da eigentlich aufging, weit auseinander gehen.
Von der Erklärung, die Ostdeutschen hätten vor 1989 nun einmal das autoritäre Regiertwerden verinnerlicht, der von der SED propagierte Antifaschismus hätte den latenten Rechtsextremismus im Osten erst befeuert oder es sei eben die Marginalisierung der Ostdeutschen in den wilden Jahren der Transformation gewesen, die die Ostdeutschen quasi aus Wut zu den radikalen Rechten laufen ließen.
Oder war es genau der Sündenfall der SPD von 2005, als sie mit der „Agenda 2010“ ihrer eigenen Klientel, den Arbeitern und Malochern, den Stinkefinger zeigte? Eine Gesetzgebung, der gerade bei vielen Ostdeutschen, die immer wieder mit gebrochenen Berufswegen im Arbeitsamt landeten, ganz schlecht ankam?
Briefe an die Mächtigen
Das sind alles Erklärungen, die sich anbieten, die aber nicht unbedingt die Frage beantworten, ob die Ostdeutschen jetzt zu blöd für die Demokratie sind. Oder ob das auch nur eine Unterstellung von Wissenschaftlern ist, die gern ihre eigene Sicht auf das verflixte deutsch-deutsche Verhältnis bestätigt sehen möchten. Aber wie bekommt man heraus, wie die Leute über Demokratie denken, wenn man sich nicht auf die üblichen Umfragen beschränken will? Wo kommen die Wählerinnen und Wähler tatsächlich zu Wort?
Denn Fakt ist eben auch dies: Das öffentliche politische Gespräch führen die bezahlten Politikerinnen und Politiker. Die Wähler kommen da nie zu Wort. In der DDR waren sie erst recht nicht gefragt, auch wenn eine Staatsdoktrin das Mitmachen aller propagierte. Aber gemeint war das Mitmachen im Sinne der allein regierenden Partei, nicht im Anspruch, tatsächlich demokratisch wählen zu dürfen.
Aber es gibt Quellen, wo man die Äußerungen der Bürger, auch der DDR-Bürger, finden kann: in Briefen an die Mächtigen. Im Westen ganz offiziell z.B. in Briefen an die jeweiligen Bundespräsidenten oder nach 1990 in solchen an die Gemeinsame Verfassungskommission des Bundestages, die darüber beriet, ob und wie auch ostdeutsche Wünsche ins Grundgesetz einfließen könnten.
Doch die Kommission blieb ohne Ergebnisse – aber nicht wegen der darin vertretenen ost- und westdeutschen Akteure, sondern weil der Riss tatsächlich zwischen Konservativen und Progressiven verläuft.
Es muss demokratisch aussehen …
Was schon einmal ein Schlaglicht auf die Ergebnisse wirft, die Christina Morina über die demokratischen Sichtweisen in Ost und West erzielt, indem sie die bis ungefähr 1993 verfügbaren Briefe auswertet nach den darin geäußerten Wünschen und Vorstellungen. Und nach dem Selbstverständnis der Briefschreiber als Demokraten, Staatsbürger, Bundesbürger.
Und das Verblüffende ist: Es gibt solche Briefe auch aus der Spätzeit der DDR – fein säuberlich gesammelt in den Archiven des MfS, wohin sie von staatlichen Institutionen und ostdeutschen Zeitungsredaktionen gesandt wurden, die sich oft genug selbst schon als Hüter der ostdeutschen Staatsdoktrin verstanden. Aber die Ostdeutschen schrieben trotzdem, nach der Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki 1975 auch durch Erich Honecker, sogar noch mutiger.
Mit dieser Unterzeichnung wurde für sichtlich immer mehr DDR-Bürger die Frage latent, inwieweit nicht nur Menschenrechte in der DDR gewährt wurden, sondern auch, wie die eigentlich seit 1949 proklamierte (Volks-)Demokratie tatsächlich funktionierte.
Eine „sozialistische Demokratie“, wie es Morina definiert, die eigentlich all die Jahre und auch in den beiden Verfassungen der DDR nur als Proklamation existierte, ganz in dem Sinne jenes Spruches, den Walter Ulbricht schon 1945 von sich gegeben hatte: Es müsse demokratisch aussehen, aber die führende Partei müsse alles im Griff behalten.
Was aber wiederum die Frage aufwirft, wie dann die Bürger eines solchen Landes trotzdem das Gefühl haben können, dass ihr Land demokratisch wäre und die Meinung der Bürger tatsächlich gefragt sei. Und da kommt Morina natürlich einem Topos auf die Spur, der 45 Jahre lang die Propaganda bestimmte und ein Staatswesen suggerierte, in dem jeder Bürger gleichberechtigt mitwirken konnte. Das „Mitregieren“ als permanente Behauptung und Forderung, die freilich ihre Grenzen da fand, wo der Eigenwille der Bürger aus den staatlich vorgegebenen Rastern ausbrach.
Ein Labor für die Demokratie
Und das wird auch in den Briefen sichtbar, die dieses postulierte „wir alle“ nun auch als Maßstab gegen die „Partei- und Staatsführung“ kehrte, oft sogar mit der Haltung des aktiven sozialistischen Staatsbürgers, der das Versprechen auf das gemeinsame Lösen der Probleme ernst nahm und die Genossen da oben mahnte, dieses – demokratische – Mitwirken für die engagierten Bürger des Landes auch ernst zu nehmen.
Wie ernst die Regierenden es nahmen, zeigt allein schon die Tatsache, dass die Briefe in den Akten des MfS landeten, das alle diese Ansprüche, Demokratie und Mitsprache im sozialistischen Musterländchen tatsächlich erlebbar zu machen, als staatsgefährdend und subversiv einordnete.
Und trotzdem kann Morina feststellen, dass diese Briefe eben gerade davon erzählen, dass die Bürger der DDR den Anspruch an ein demokratisches Staatswesen durchaus ernst nahmen und reale Mitsprache einforderten. Sie hatten sehr lebendige Demokratievorstellungen, die in den entstehenden Bürgerbewegungen auch programmatische Gestalt annahmen.
Der Herbst 1989 war ein regelrechtes Überschießen demokratischer Entwürfe und Vorstellungen, genährt und befeuert von der Erfahrung auf den Straßen, dass die allmächtige Diktatur wie ein Kartenhaus in sich zusammenfiel, als ihr das Volk einfach abhandenkam.
Es ist also nicht nur dieser stürmische Herbst, den die Ostdeutschen dann in den Einigungsprozess einbrachten, sondern auch eine lange Beschäftigung mit dem Zustand der eigenen Demokratie, über deren eigentliche Leere sich die meisten völlig klar waren. Die Kommunalwahlen im Frühjahr 1989 machten es offenkundig, als sich viele Bürger selbst ermächtigten, die Wahlergebnisse in ihren Wahllokalen zu überprüfen und die Funktionäre beim Fälschen ertappten.
Was als ein direkter Verrat auch am gemeinsamen „Wir“ verstanden wurde.
Wer ist das Volk?
Möglicherweise ist das auch genau die Stelle, die erklärbar macht, warum so viele Ostdeutsche heute eine rechtsradikale Partei wählen, enttäuscht von einer Demokratie, in der sie sich marginalisiert fühlen. Obwohl sie das nicht wirklich sind. Die Bilanz nach 30 Jahren deutscher Einheit ist viel besser, als es in den deutsch-deutschen Wehklagen oft wahrgenommen wird. Aber Gefühle machen Politik. Und auch Vorstellungen von Demokratie, die nicht hinterfragt werden.
Das wird gerade in den Briefen der Bundesbürger in der alten Bundesrepublik deutlich, die sich sehr wohl als Staatsbürger und Steuerzahler begriffen und aus dieser Position heraus auch ihre Vorstellungen und Erwartungen äußerten. Oder ihr Unverständnis für den Zustand der Bundespolitik. Aber die Briefe erzählen eben auch von einem Demokratieverständnis, das eben nicht davon ausgeht, dass Politik etwas sein muss, das alle gleichermaßen „beglückt“.
Oder gar die Wünsche der Wähler 1:1 abbildet. Als wären die Staatsbürger in ihrer Summe tatsächlich ein einziges Volk, das sich regelmäßig auf den Straßen trifft und ruft „Wir sind das Volk“.
Diesen Ruf aus der Friedlichen Revolution untersucht Morina recht gründlich, weil in ihm auch ein Teil der Irrtümer steckt, die sich ganz offensichtlich viele Ostdeutsche noch immer über die Demokratie macht. 1989 war dieser Ruf eine klare Absage an den Glauben der scheinbar allmächtigen SED, sie spräche für das Volk und ihre Politik sei des Volkes Wille. Doch allzu offensichtlich regierte diese Partei gründlich an „ihrem Volk“ vorbei, erfüllte also nicht einmal den Anspruch, das gemeinsame „Wir“ mit Leben zu erfüllen.
Was letztlich unüberhörbar wurde, als Erich Honecker im Oktober 1989 die aus der DDR Geflüchteten als Asoziale bezeichnete, die nicht „zu uns“ gehören. Und damit deutlich machte, dass das doktrinäre Wir immer dann endete, wenn die Funktionäre beschlossen, Menschen für asozial, kriminell, feindlich usw. zu erklären.
Der Stolz des Staatsbürgers
Man ahnt die Feind-Bilder, die heute alle wieder auftauchen, wenn eine neue selbst ernannte Volkspartei den Wählern ein volkstümliches „Wir“ anbietet und das sofort mit Verachtung und Herabwürdigung der anderen verbindet. Da trifft eine zutiefst chauvinistische Partei augenscheinlich auf eine Erwartungshaltung, die etliche Ostdeutsche (nicht alle und auch nicht die Mehrheit) in der parlamentarischen Demokratie nicht erfüllt sehen. Denn die parlamentarische Demokratie ist nicht kuschelig. Sie hat auch keinen Platz für ein volkstümliches „Wir“.
Denn sie schafft in den Parlamenten genau das, was im einstigen „sozialistischen“ Demokratieverständnis nicht denkbar war: sie Vernetzung unterschiedlichster politischer Interessen. Und damit tatsächlich eine Vertretung der Wählerschaft – egal, ob einem die Ansprüche der anderen Parteien gefallen.
Der Einfluss des Wählers auf die Zusammensetzung von Parlamenten und Regierungen ist klein. Und bei jeder Wahl muss man damit rechnen, dass wieder Mehrheiten zustande kommen, die den eigenen Wünschen völlig widersprechen. Dass auch Westdeutsche ihre Vorstellungen vom richtigen Funktionieren von Demokratie hatten, machen viele Briefe an den Bundespräsidenten deutlich.
Aber noch deutlicher wird, dass sich die Briefschreiber als Staatsbürger verstanden, welche die gelebte Demokratie durchaus zu schätzen wussten, auch wenn sie sich selbstbewusst für oder gegen etwas – etwa die Verlegung der Hauptstadt von Bonn nach Berlin – aussprachen.
Es trafen 1990 also zwei verschiedene Demokratiediskurse aufeinander. Eigentlich sogar noch viel mehr. Denn der Herbst 1989 war ja ein regelrechtes Reallabor für neue demokratische Angebote – man denke nur an das bis heute erfolgreiche Modell der Runden Tische. Oder den Wunsch nach deutlich mehr Plebisziten und damit die direkte Möglichkeit der Wähler, auf Gesetze Einfluss zu nehmen.
Ausgang offen
Aber das teilten in der alten DDR eben nicht alle Menschen. Was spätestens mit den Volkskammerwahlen im März 1990 deutlich wurde, als die Bürgerbewegung der DDR regelrecht marginalisiert und die Allianz für Deutschland der Wahlsieger wurde, der eben nicht nur die schnelle Einheit versprach, sondern auch die Übernahme des bundesdeutschen Parlamentarismus. In die Gestaltung der deutschen Einheit waren die Ostdeutschen genauso wenig eingebunden wie die Westdeutschen.
Und dass es zu keiner neuen Verfassung kam, über die dann alle Bürger der neuen Bundesrepublik abstimmen konnten, erzählt im Grunde alles darüber, was aus den Wünschen der Friedlichen Revolution nach mehr und direkter Demokratie geworden war.
So endete scheinbar die ostdeutsche Demokratieanspruchsgeschichte, wie es Morina nennt. Aber in ihrem Fazit kann sie dann feststellen, dass das eigentlich auch seither für die gemeinsame bundesrepublikanische Geschichte gilt: Es ist eine „Demokratieanspruchsgeschichte mit offenem Ausgang“. Mittlerweile gefährdet von einer populistischen Partei, die sich selbst für die einzig legitime „Volks-“Partei erklärt und die anderen Parteien, die sich in oft schwierigen Kompromissen auf eine machbare Politik verständigen, in Bausch und Bogen zu „Altparteien“ erklärt.
Als wäre der Geist der AfD etwas Modernes, und nicht das Modell einer Partei mit den autoritären Vorstellungen des späten 19. Jahrhunderts. Bismarck lässt grüßen.
Mit Habermas erinnert Morina daran, dass Demokratie immer etwas Fragiles und Gefährdetes ist – geprägt von den Geschichten, die sich eine Gesellschaft über sich selbst erzählt. Und damit auch über die Ansprüche, die sie an die Verwirklichung „republikanischer Freiheiten“ stellt. Das berührt nun einmal die Frage der Wirksamkeit.
Denn die empfindet jeder anders, jemand, der erwartet, eine Partei würde geradezu den Volkswillen umsetzen, völlig anders als jemand, der weiß, dass das Wichtigste in der Demokratie die Rechte und Freiheiten sind, die für jeden Bürger gleichermaßen gelten. Die auch nicht genommen werden können. Oder nicht genommen werden dürften.
Der republikanische Staatsbürger in dem Sinn definiert sich eben nicht dadurch, dass gewählte Politiker das umsetzen, was er sich in seiner kleinen Allmächtigkeit wünscht, sondern durch die selbstverständliche Wahrnehmung seiner Rechte.
Eine Haltung, die längst auch viele Ostdeutsche verinnerlicht haben. Es gab eben 1989 nicht nur den einen Aufbruch. Morina warnt sogar davor, die Jahre 1989/1990 „im Sternstundenmodus“ zu verhandeln. Man sollte schon genauer hinschauen und wahrnehmen, dass es eben viel mehr und völlig unterschiedliche Aufbrüche mit oft völlig verschiedenen Erwartungen gab. Auch mit erwartbaren Enttäuschungen und Frustrationen, erst recht in der Tansformationszeit der 1990er Jahre, die für die meisten Ostdeutschen eben auch ein völliges Umstülpen aller Lebensverhältnisse bedeuteten.
Erstaunlich ist, dass Morina für 1989/1990 konsequent den Begriff des Umbruchs wählt. Was aber eben auch die westdeutsche Perspektive mit erfasst. Auch wenn sich nicht nur die Kohl-Regierung eifrigst darum bemühte, der alten Bundesrepublik möglichst jede Veränderung zu ersparen, entstand trotzdem ein neues Land und musste sich auch der Westen verändern und neu orientieren. Und sei es auch nur im gemeinsamen Lamento über die schrecklich hohen Kosten der deutschen Vereinigung.
Wobei Morina am Beispiel von Angela Merkel zeigt, dass ostdeutsche Politiker/-innen ganz und gar nicht einfach verschwanden, sondern ein teilweise sehr gut sichtbarer Bestandteil bundesdeutschen Politik wurden. Nur dass Merkels Schweigen über ihr Ostdeutschsein irritiert, genauso wie ihre sichtliche Zurückhaltung, die spezifischen ostdeutschen Probleme in ihrer Amtszeit dezidiert anzugehen. Also eben nicht zur „Muddi“ für frustrierte Ostdeutsche zu werden.
Falsche Schablonen
Aber „die Ostdeutschen“ gab es nie und gibt es nicht. Das wird eigentlich auch mit Morinas Reise durch die Brieflandschaften ostdeutscher „gelernter Staatsbürger“ deutlich. Dabei opponiert sie auch gegen Dirk Oschmanns erfolgeiches Buch „Der Osten, eine westdeutsche Erfindung“.
Aber gerade an dieser Stelle wird auch deutlich, wie sehr das „angelernte“ Wir-Gefühl der Ostdeutschen mit der summarischen Fremdzuschreibung des Westens korrespondiert. Es sind in beiden Fällen Konstrukte, die ein einziges Großes, Ganzes suggerieren und aus lauter Faulheit auf Differenzierungen verzichten. Verstärkt durch die polemische Nutzung dieser Topoi nicht nur in meinungsstarken Medien, sondern auch in ost- und westdeutscher Politik.
Mit der Konsequenz, dasss man schon eine Menge Aufmerksamkeit braucht, um hinter diesen Schablonen der gegenseitigen Markierung die eigentlichen Stärken einer demokratischen Gesellschaft zu erahnen. Einer Gesellschaft, die keine „Volksgemeinschaften“ mehr braucht, um sich immerfort gegen andere abzugrenzen. Denn da warten noch ganz andere Herausforderungen auf uns als dieses deutsch-deutsche Watschenverteilen.
Daran erinnert Morina mit Verweis auf die vielen anderen Bevölkerungsgruppen, die in diesem Diskurs gar nicht vorkommen, aber selbst eine lange Geschichte des Ringens um Gleichberechtigung hinter sich haben.
All die Menschen, deren Status in unserer Gesellschaft noch viel labiler ist als jener der vermeintlich unerhörten Ostdeutschen. Genau da wird sichtbar, wie schwer sich die Deutschen in Ost und Welt tatsächlich noch mit dem Projekt Republik tun. Wie gern sie zurückfallen in alte, nationalistische Vorstellungen vom Regieren und Regiertwerden. Und wie wenig sie das mühselige Geschäft der Demokratie goutieren, in dem sich Parteien unterschiedlichster Couleur immer auf das Machbare einigen müssen. Das aber nie das ist, was sich der Wähler von Herzen gewünscht hat.
Was bleibt eigentlich als Fazit? Vielleicht schlicht die Vorstellung, dass einige Erzählungen über das deutsch-deutsche Missvergnügen in ihrer Einfalt einfach nicht stimmen. Vor allen Dingen erfassen sie nicht die Vielzahl von Aufbrüchen, Ermutigungen, Experimenten und Lebenserfahrungen der Deutschen in Ost und West nach jenem dennoch aufregenden Herbst 1989.
Nur dass es Demokratie nie als fertiges Nudelgericht in der Tiefkühltruhe gibt, sondern immer nur als ein Provisorium, einen Prozess auf der Suche nach dem Unsetzbaren. Und da muss man sich vielleicht auch einmal zugestehen, was trotz allem erreicht wurde.
Was aber nie endgültig ist. Erst recht nicht, wenn Populisten all des wieder zu demolieren versuchen, was eigentlich den Kern der Demokratie ausmacht.
Christina Morina „Tausend Aufbrüche“, Siedler Verlag, München 2023, 28 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
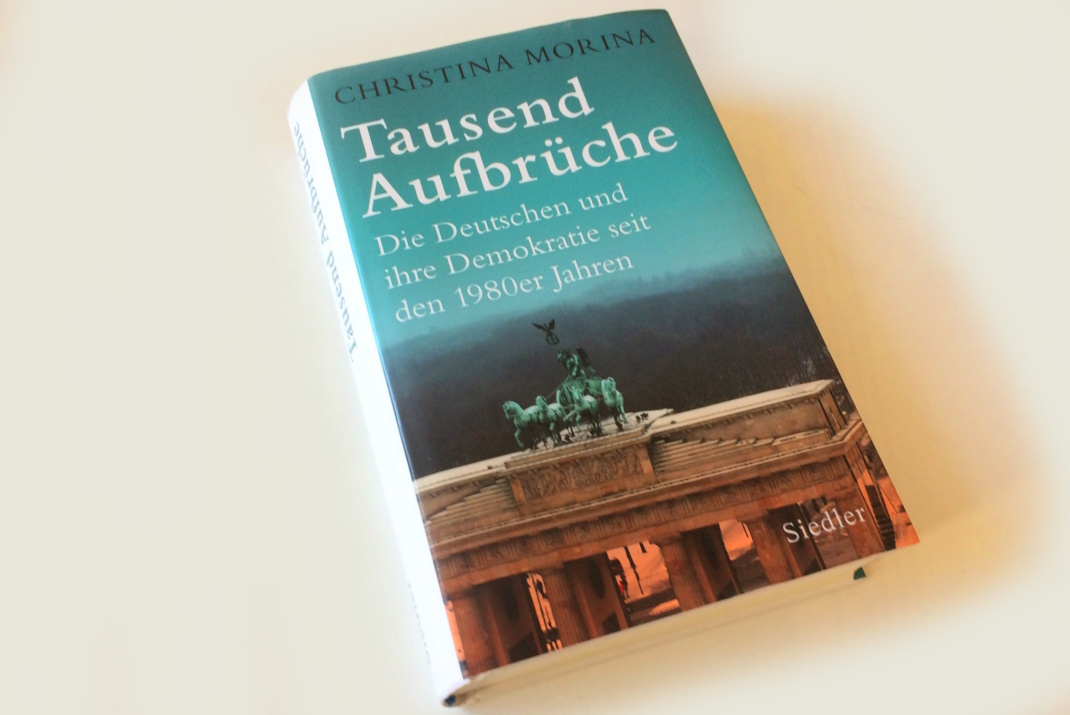

































Keine Kommentare bisher