Eigentlich passt kaum etwas so gut in diese Zeit des zuweilen erzwungenen Stillehaltens wie Gedichte. Jene meist kurzen und knappen und dichten Texte, die sich erst richtig erschließen, wenn man sich Zeit und Aufmerksamkeit für sie nimmt. Ja, genau das, was einigen Leuten so schreckliche Kopfschmerzen bereitet, weil sie das mit sich selbst konfrontiert. Dabei wird die Welt für uns so erst ahnbar. Wie in den Gedichten Wolfgang Rischers.
Zur Ruhe und Besinnung war der 1935 in Hamburg Geborene sowieso über Jahrzehnte verdammt. Denn sein Heimatort Süpplingen bei Helmstedt lag 40 Jahre lang im Zonenrandgebiet. Da war situationsbedingt nicht viel los. Außer dass man dort schnell mitbekam, wenn an der scharf bewachten Grenze wieder etwas passierte.
In stillen Nächten konnte man das Klappern der Gewehre der Grenzsoldaten hören, im Frühjahr zuschauen, wie drüben auf den LPG-Äckern die Maschinenkolonnen fuhren. Ansonsten war es ein ruhiger Ort. Einer, der zu langen Spaziergängen an der Elbe einlud, zur Beobachtung der Natur, zum Schweifenlassen der Gedanken. Zur Selbst-Besinnung, mit der jedes Dichten beginnt.
Bei Rischer hat das immer auch eine historische Dimension. Immerhin gehört er zu einer Generation, die Geschichte noch in ihrer grausamen Wucht erlebt hat. Dass seine Familie Hamburg verlassen musste, hat mit dem Bombardement der Hafenstadt im Zweiten Weltkrieg zu tun. Auch die Evakuierung taucht motivisch in seinen Gedichten auf, genauso wie das alte Radio, mit dem die Töne des schrillen Hitlerreiches in seiner Kindheit plärrten.
Na gut: Plärren würde er nie schreiben. Das ist nicht sein Stil. Er hat sich eher an den nachdenklichen, schweifenden Dichtern in deutscher Sprache orientiert, auch wenn er im Kurzinterview zu seinem Dichten launig ablenkt und lieber Georg Christoph Lichtenberg erwähnt, den großen aphoristischen Physiker aus dem nahe gelegenen Göttingen, oder Günter Kunert und Wilhelm Müller. Was nur beweist, dass der 85-Jährige auch ein Vielbelesener ist, der sein volles Buchregal nicht ohne Grund beiläufig erwähnt.
Was aber auch wieder nur Tapete ist. Oder geistige Landschaft. Anregung für das, was einer wirklich denkt und ausformuliert, bis er das Gefühl hat: Ja, das trifft es jetzt. „,Das Gedicht ist ein Hallraum‘, schrieb ich einmal in einem eher poetologisch ausgerichteten Gedicht“, sagt er im Interview, das auch dieses freundlich personalisierte „Poesieabum neu“ zu seinem 85. Geburtstag enthält.
Das vierte, das derart enge Mitstreiter der Gesellschaft für zeitgenössische Lyrik würdigt. Viele Jahre hat er selbst im Vorstand der Lyrikgesellschaft mitgewirkt, hat auch immer wieder eins seiner nachdenklichen Gedichte beigesteuert, wenn in der Reihe „Poesiealbum neu“ ein neues Themenheft geplant war.
Jedes dieser Themenhefte eigentlich ein verdichteter Kommentar zum Zeitgeschehen. Aus der Sicht zutiefst nachdenklicher Menschen, was einem erst richtig bewusst wird, wenn man diese Texte neben das oberflächliche Gerede der öffentlichen Medien hält, das so sehr von Eile, Kurzatmigkeit und Nicht-Nachdenken geprägt ist. Dichtung ist im Grunde ein veritables Seitenstück zur Wissenschaft. Nur dass Dichter die Welt auf ihre Weise intensiv erforschen. Ihr Material sind nun einmal Worte in all ihrer Musikalität und Vieldeutigkeit.
Was man wiederum nur merkt, wenn man geübt hat, seine Gedanken schweifen zu lassen. Im Alltäglichen und Allgegenwärtigen das Unverhoffte und Überraschende zu entdecken, selbst beim Nachdenken über Wissenschaft und die Bilder, die uns auch neuerdings ja wieder zum Thema Wissenschaft in die Köpfe gehämmert werden: „Hinter den Fassaden der Forschungsinstitute / weltweiter Wettlauf der Karrieren / Eitelkeiten. Nur die Erst-Veröffentlichung / einer Entdeckung zählt für das Who’s-Who …“.
So zu lesen in seinem Gedicht „Lob des Labors“, eins von denen, die für diesen Jubiläumsband ausgewählt wurden, beispielhaft für das, was er schreibt und wie er die Dinge sieht: mit gehöriger poetischer Skepsis. Und natürlich belässt er es nicht beim „Wettlauf der Karrieren“. Dazu weiß er zu gut, dass die Forschenden da hinter den Fassaden ganz und gar nicht freiwillig in einem irren Wettlauf jagen. Und schon gar nicht nach Ruhm. Ihre Arbeit ist mühsames Entziffern der Welt, diesem „Buch mit sieben Siegeln, an dem die / Teams weiter zu knacken haben werden …“
Was Dichter eigentlich nachvollziehen können, auch wenn sie nie im Team arbeiten und die Zeitungen nicht in Jubelgesänge ausbrechen, wenn sie ihre Funde zum Welterkennen beitragen – als Gedichtband in einem kleinen Verlag zumeist, der oft nicht lange am Markt ist. „Ich, der Laie“, schreibt er von sich selbst. Und identifiziert sich letztlich mit den „Helden hinter den Schleusen der / Reinraumlabore im Schatten der NAMEN“.
Womit er ja geradewegs ein Gedicht zum Jahr 2020 geschrieben hat, unbeabsichtigt und folgerichtig. Weil Dichter sich genau jene Zeit zum Drübernachdenken nehmen, die die gestressten Jetzt-Zeit-Bewohner sich nicht nehmen. Oder sich fürchten davor, sich diese Zeit zu nehmen und sich wieder dessen gewahr werden, was wirklich passiert. Und wirklich von Bedeutung ist. Auch morgen noch. Dichten schärft den Blick für das Eigentliche. Und für die Wirkung von Worten, wenn man sie richtig verwendet. So wie in „Bei Hornburg“: „Auf dem Hügelweg wächst Gras / über unsere Erinnerungen. Plötz- / lich, ja doch!, der Metallgitterzaun …“.
Oder wie in „Die Dömitzer Brücke“, einem seiner Gedichte, die in diesem Heft von anderen Dichtern aufgenommen und erwidert werden: „Wirklichkeit ist auch das Fehlende, ist / was nicht ist. Das Winken ist noch immer / keine Brücke …“.
Die „Dömnitzer Brücke“ entstand 1988. Sie überspannte bis zu ihrer Sprengung 1945 die Elbe und verschwand dann praktisch vier Jahrzehnte lang im Grenzgebiet. Und ein Winken von Ufer zu Ufer ersetzte die Nähe natürlich nicht.
Weil Dichter das Gesehene nicht übersehen, sehen sie mehr. Und neigen auch deshalb nicht zur großen Geste, zum Lärm oder zur Polemik. Denn diese Intensität der Welt-Wahrnehmung macht bescheiden, ernsthaft und hochgradig aufmerksam. „An einem dieser durchsichtigen Tage. / Die alte Frage: Was bleibt / : Viel wiegt es nicht, aber alles“, bringt er es – einmal mehr – auf den Punkt in „Das Gedicht“.
Vielleicht werden Gedichte deshalb so unterschätzt. Für zu leicht genommen. Obwohl sie auch noch in Generationen zu den Leserinnen und Lesern sprechen werden, wenn von unserem heutigen Tageslärm schon nichts mehr interessiert. Dichter sind geübte Wanderer. Sie sind schon längst da, wenn die lärmende Menge erst mit Bohei aufbricht ins Kommende.
Selbst ein Gedicht wie „Kurztrip, Stromabwärts“ wirkt da auf einmal wie hineingeschrieben ins Jahr 2020. Es beginnt mit dem Bild einer Fahrt auf dem Sonnendeck eines Donauschiffes und endet mit dem Donaukreuzfahrt-Prospekt auf dem Rasen, „bewegt vom tierischen Erdarbeiter / der beharrlich meinen Rasen aufhügelt & / noch weniger herauskommt als ich“.
Es ist ein warmherziger Gruß zum 85. Geburtstag, den die Gesellschaft für zeitgenössische Lyrik hier zusammengestellt hat. Natürlich auch mit Grußworten und den erwähnten Gedichten, in denen Dichter/-innen den Dichter reflektieren. Der selbst wieder andere reflektiert, wie das unter Dichtern nun einmal so ist, die einander stets Antwort geben in einem Gespräch über die Zeiten hinweg.
Wohl wissend, dass das Menschsein immer ganz ähnlich ist, egal, wie grimmig die Zeiten sind. Sie sind sich des unsicheren Moments immer bewusst, selbst wenn sie bei Brecht anknüpfen: „Keine Ahnung woher. / Keinen Schimmer, wohin. / Die Zukunft ist ein Sog, jedes Ziel / nur ein vorläufiges …“
Wenn man das weiß, lebt es sich ruhiger und intensiver. Und dann bekommt man auch so ein Heft zum 85. Geburtstag. Was will man mehr?
Poesiealbum neu „Wolfgang Rischer zum Fünfundachtzigsten“, Edition kunst & dichtung, Leipzig 2020.
Die kleine Frage „Was bleibt?“ und der erinnerungsreiche Tummelplatz von Schrödingers Katze
Die kleine Frage “Was bleibt?” und der erinnerungsreiche Tummelplatz von Schrödingers Katze
Leipziger Zeitung Nr. 85: Leben unter Corona-Bedingungen und die sehr philosophische Frage der Freiheit
Hinweis der Redaktion in eigener Sache
Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten unter anderem alle Artikel der LEIPZIGER ZEITUNG aus den letzten Jahren zusätzlich auf L-IZ.de über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall zu entdecken.
Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.
Vielen Dank dafür.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
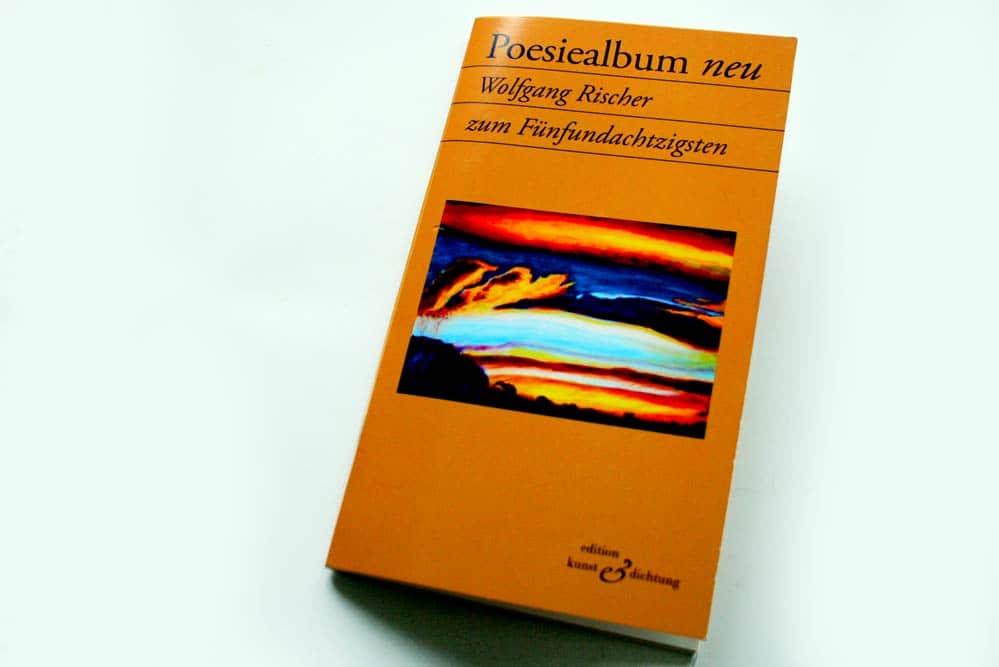














Keine Kommentare bisher