Es gibt ja Leute, die wittern mal wieder so eine revolutionäre Situation. Man lässt sich ja vom Geschrei in allen möglichen Kanälen gern in die Irre führen. Dass sich einige Leute einen gewaltsamen Umsturz wünschen, ist dabei nicht zu übersehen. Nur sehen die nicht wie Revolutionäre aus, sondern eher wie grantige alte weiße Männer, die nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht. Und was sagen die Dichter? Die sind doch sonst wie Seismographen?
Sind sie auch. Und in der Regel haben sie auch nicht vergessen – soweit sie etwas älter sind – wie sich eine richtige Revolution anfühlt. Und dass aus Sorge um den ach so verdienten Wohlstand des wütenden Bürgers je eine Revolution ausgebrochen wäre, das wäre auch mal was Neues. Dazu haben die Wohlversorgten viel zu viel Angst davor, dass „kein Stein auf dem anderen bleibt“, wie Holger Brülls in seinem Gedicht „revolutionsetüde II“ schreibt.
Eine Revolution, in der das nicht so ist, „ist jedenfalls keine sondern / wie umzug aus einer verschimmelte wohnung / in einen neubau am anderen ende der stadt“.
Das ist die Perspektive von unten, die Perspektive von „Ungerechtigkeit, Armut und Not“, die Wolfgang Thierse im Vorwort anspricht, zutiefst hoffend, dass die Demokratie es schaffen werde, die multiplen Krisen zu meistern, die unsere Gesellschaft erschüttern. Wobei er – wie auch viele Autor/-innen in diesem Gedichtband – weiß, dass sich auch die Parteien nicht an das eigentliche Ungetüm wagen, das unsere Welt derart an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gebracht hat: „Es beschleunigt sich die Globalisierung mit ihren ökonomischen, technischen und wissenschaftliche Entgrenzungen.“
Das ist der Elefant, der im Raum steht und über den nicht gesprochen wird: ein völlig entfesselter Kapitalismus, der – wegen seiner Entgrenzungen – unsere Lebensgrundlagen gefährdet, die politische Stabilität, den Frieden sowieso.
Kein Platz für die Revolution
Kein Wunder, dass viele Dichter/-innen da eher Ohnmacht verspüren, als rebellischen Geist zum Aufstand. Und selbst wenn einer dereinst die Attitüde des Barrikadenkämpfers pflegte, der „Revolutionär des Quartiers“, längst ist er heimgekehrt aus „seinem vieljährigen Krieg / Zwischen den zündelnden Worten“, stellt Gisela Herman in „Von weit her“ fest. Zurück blieben: die „Adorantinnen“.
Man hört ihnen ja nur zu gern zu, den feurigen Anfeurern, die sich danach in brave Couchpotatoes verwandeln. Oder die Seiten wechseln. Sich ein gemütliches Plätzchen suchen. Denn wer die Welt ändern möchte, müsste schon mehr riskieren als falschen Applaus.
Lässt sich diese Welt überhaupt ändern? „Zwischen Klima und Atom, / ist da noch Platz für eine Revolution?“, fragt Hanno Hartwig in „Revolution“. Womit dieser schöne, blankpolierte Begriff fragwürdig in der Gegend steht. Und die Frage steht: Was ist eigentlich Revolution? Geht es mit dem Burschen los, der den ersten Faustkeil schlug, wie Wolfgang Stock in „Ich schlug mir einen neuen Prototypen“ andeutet? „Vergesst die zufällig gefundenen Steine …“
Aber Prototyp, das erinnert auch an die großen Konzerne, die ihre neuen Konsumverführungen nur zu gern als Prototypen verkaufen. Jedes neu gestylte Produkt – eine Revolution. Ein zum Marketing-Gedöns verkommenes Wort, nicht mehr ernst zu nehmen, wenn es Manager und Werbeheinis im Mund führen. Und deshalb vielleicht gerade tot. Mausetot. Und den Möchtegern-Revoluzzern bleibt die Disco wie in Gerald Martens Gedicht „Wir spielen dich nur“. Zum Kern gepresst in den Zeilen: „Die Haare lang, das Leben kurz / die Politik den meisten schnurz.“
Verstummter Zorn
Da kann man sich gut als Revolutionär am Biertisch gerieren, alles besser wissen und von nichts eine Ahnung. Revolution quasi als Lösung aller Probleme von Männern, die keine Lust haben, sich – frei nach Thierse – mit der Mühle der täglichen Politik zu beschäftigen. In den Reden der Revolutions-Apostel ist alles ganz einfach, wird tabula rasa gemacht, aufgeräumt. Ein „eiserner Besen“ kehrt und ein fieberäugiger „Führer“ gibt die Marschroute an.
Dass die Sache auch völlig in die Binsen gehen kann, wissen die, die einmal gehofft haben. Wie in Grit Kurths Gedicht „Ich wollte doch“: „Mein Kind, ich bin müde. Die Waffen sinken / Verstummt ist mein Zorn. Es hat nichts genützt.“
Ein Gedicht zum Stolpern, denn der Leipziger Dichterin geht es wie so vielen Eltern, die feststellen mussten, dass ihren Kindern nun eine Zukunft blüht, die sie so nicht gewollt haben: „Dort staunen die ewigen Sterne und blinken. / Ich hätte dich gerne besser beschützt.“ Zeilen, die mit den Hoffnungen korrespondieren, die einmal da waren: „Mein Kind, ich wollt’ große Schlachten schlagen / gegen Herzensgifte und Gier im Hirn.“
Da steckt sie, die Niederlage gegen den Elefanten im Raum. Der auf den Gefühlen der Kinder genauso lustvoll herumtrampelt wie auf dem letzten Stückchen Grün. Auch Jochen Stüsser-Simpson thematisiert ihn: „beiseite schiebt die überdrehten / Wirtschaftskonzepte, stellt euch quer“. Denn sie zerstören unsere Lebensgrundlagen.
Man merkt schon: Diese Dichterinnen und Dichter zweifeln daran, dass jetzt Zeit für eine Revolution ist. Wer sollte sie auch machen? Mit welcher Kompetenz? Wenn nicht einmal klar ist, gegen wen sie gerichtet wäre?
Nach uns die Flut?
Wenn die Demokratie ihr Opfer wird, ist das eine Katastrophe. Und ein Verrat an unseren Kindern erst recht. „wir müssten aufhören zu lügen“, stellt Carmen Jaud fest. Insbesondere die Kinder sollten wir nicht mehr anlügen. Denn Veränderung kommt. So oder so. Manchmal still und sachte, wenn Menschen sich selbst ändern. Manchmal mit Wucht und als Flut, weil menschliche Dummheit sich nicht belehren lassen will.
So wie in Carsten Stephans „Flut“: „Dem Bürger wird die gute Hose nass / Gepflegte Autos gründeln in den Straßen …“ 2023 alles mehrfach in Nachrichtenkanälen besichtigt. In nah und fern. Wenn gerade jemand revoltiert, dann ist es das Klima. Und es haut mächtig zu. Das Weheleid der durchnässten Bürger ist ihm egal. Wie alle unsere Lügen und Ausflüchte.
All diese Beschwörungen des „maßvollen Gangs der Dinge“, die Eline Menke aufs Korn nimmt.
Dichterinnen pflegen eben in der Regel nicht den revolutionären Ton. Einen Freiligrath oder Majakowski wird man in diesem Band nicht finden, eher ironische Bezüge zu Brecht. Und die berechtigte Erinnerung daran, dass man wohl besser nicht die große Revolution fordert, wenn man nicht mal sein eigenes Leben auf die Reihe bekommen hat.
So wie es Manfred Moll auf den Punkt bringt in „vorbei“: „schlimm ist nicht / dass wir nicht gewesen sind / was wir hätten sein können“, schreibt er. Um am Ende deutlich zu werden: „aber dass ich nicht gewesen bin / was ich hätte sein wollen / das ist schlimm.“
So machen das die Dichter – wenn sie nicht gerade, wie im ersten Teil des Heftes, die durchaus missglückten Revolutionen der deutschen Vergangenheit betrachten, da und dort mit Mitgefühl, aber auch mit viel Skepsis. Denn die Frage steht immer: Was bleibt? Und was kommt? Und was machen wir eigentlich aus unserem eigenen Leben?
Oder bleibt uns dann nur noch das Lachen, wie Gisela Verges in „Friedliche Gegenwehr“ schreibt? Weil uns keiner das Lachen verbieten kann?
Die Aktienkurse knirschen
Im Gedicht liest sich das schlüssig. Aber die Summe der Gedichte stimmt nachdenklich, denn die Zustandsbeschreibung unserer Wirklichkeit verspricht eben keine Revolution, nur eine riesige Blamage. Wie es Jürgen de Bussman beschreibt in „Sonst“: „Der Himmel fliegt im Überschall / Die Aktienkurse knirschen / Ein Präsident hat Brechdurchfall / Er kann sich nicht beherrschen …“
Da seufzt man dann mit Wolfgang Thierse, der so berechtigt fordert: Die „Modernisierungs- und Reformpolitik“ darf „keine Klientelpolitik sein oder als solche erscheinen.“
Dumm nur, wenn sie genau so erscheint und die Vollstrecker der Klienten lärmen, weil sie die Macht gern wieder zurück hätten. Dieses goldene Ding, an dem sich die Redner berauschen, während sie ihr tiefgläubiges Publikum belügen und täuschen. Und ihm gar Bilder allerwildester Revolutionen in die Hirne pflanzen, auf dass sie alle folgen, wenn der Leithammel ruft.
Revolutionäre Zeiten?
Wohl eher nicht.
Die Vision einer besseren Welt
Wohl besser nicht. Oder mit den schönen Zeilen von Olaf Rendler gefragt: „Oder bin ich frei / wenn mir / die Sicherungen durchbrennen? / Ich weiß nur / sinnvoller Widerstand / macht Licht.“
Denn wer sich dem Lärmen verweigert, vernebelt nicht alles mit Phrasen und Hülsen. Wahrscheinlich entdeckt er dann den dicken Elefanten im Raum, der selbst das einst so störrische Wort Revolution in Marketingschleim verwandelt hat. Denn wenn alles revoltiert, bleibt alles beim Alten und die im Dunklen machen ihre besten Geschäfte.
Bleiben: Erinnerung (à la Andreas Reimann) und das „nicht als gegeben hinnehmen“ der Dinge, wie es Erich Pfefferkorn in „ruhig revolutionär“ bedenkt. Denn damit fangen Veränderungen an: dem Nachdenken, mit den Geschichte geschieht – „hier / und / jetzt“.
Was man gern unterschätzt. Veränderungen fangen im Kleinen an. Bei uns selbst. Bei der nicht unwesentlichen Frage, ob wir eigentlich je versucht haben zu sein, wer wir sein wollten. Oder nur den blökenden Hammeln nachgelaufen sind. Die Frage bleibt stehen. Ganz klein. Aber ehrlich. Erst so beginnt es, dass wir „der vision von / einer besseren welt / raum“ geben, wie Eva-Maria Berg in „zu jeder Zeit“ schreibt. Oder Rüdiger Strüwe in „Immer wieder“: „Der kleine Mut / wächst nicht auf den / Bäumen …“
Gesellschaft für zeitgenössische Lyrik (Hrsg.) „Poesiealbum neu: Revolution“, Edition kunst & dichtung, Leipzig 2023, 7,80 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
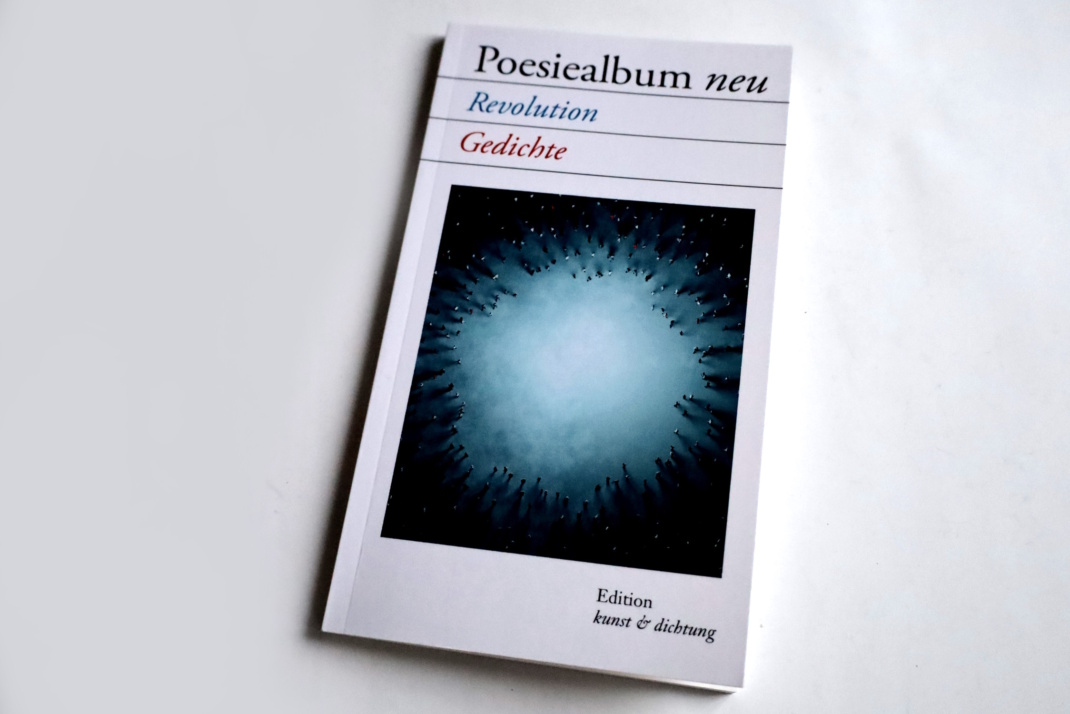




















Keine Kommentare bisher