Wird er überschätzt? Wird er unterschätzt? Vor 250 Jahren wurde Klemens Wenzel Lothar von Metternich in Koblenz geboren. Im Gedächtnis geblieben ist er als der große Dirigent des Wiener Kongresses und als österreichischer Staatskanzler und Außenminister. Und irgendwie auch als Konstrukteur des europäischen Friedens, den dieser Kongress nach 23 Jahren Krieg brachte. Und der dann anhielt – ja wie lange eigentlich? 100 Jahre? 50? Zeit, sich mit dem Mann mal wieder zu beschäftigen.
Denn dass es ihm gelang, auf dem Wiener Kongress tatsächlich so etwas zu schaffen wie eine stabile Friedensordnung, ist eher unbestritten. Der Münchner Historiker Wolfram Siemann schildert in seinem Beitrag zu diesem Buch sehr diplomatisch, wie es dem Chefdiplomaten der Habsburger gelang. Denn natürlich geht es um Diplomatie, die eine Kunst ist. Und zwar eine, in der Leidenschaften nichts zu suchen haben. Auch deshalb ist ja der Wiener Kongress bis heute eine Art positives Beispiel, wie man einen vom Krieg zerrissenen Kontinent wieder befriedet und eben nicht – wie 100 Jahre später in Versailles – neue Ressentiments schafft, die den Boden für den nächsten Krieg bereiten.
Und so liegt der Berliner Wissenschaftsjournalist Eberhard Straub gewaltig daneben, wenn er in seinem Beitrag tatsächlich meint: „Die Wiener Friedensordnung hielt im Großen und Ganzen bis 1914.“ Er ist der Einzige in dem Buch, der so eine steile These aufstellt. Dagegen sprechen schon Jahreszahlen wie 1866, 1871 oder die des Krimkrieges 1853 bis 1855.
Im Zeitalter der Revolution
Und auch Klemens von Metternich selbst hätte widersprochen. Denn das fein austarierte System der Verträge, das er in Wien aushandelte, zeigte schon zu seinen Lebzeiten Sprünge und Risse. Aus nur zu gut bekannten Gründen, wie Metternich selbst feststellte: denn Eitelkeiten der Mächtigen und ihre völligen Kenntnislosigkeit dessen, was sie anrichteten, wenn sie auf ihrem Thron den harten Macker markierten, hatten unberechenbare Folgen. Auch für diverse Päpste in Rom, die die Zeichen der Zeit nicht erkennen wollten und die mit sturer Unberatenheit wieder so auftreten wollten, wie die mächtigen Päpste des Mittelalters. Politik ist nun einmal auch die hohe Kunst, Folgen abschätzen zu können. Für Metternich eine ganz zentrale politische Tugend.
Metternich war ein konservativer Politiker. Doch Diplomatie betrieb er mit der Geschmeidigkeit eines vergangenen Zeitalters – des 18. Jahrhunderts, in dem er aufgewachsen war. Und dessen Glanz er verglühen sah. Denn als geborener Rheinländer erlebte er die Auswirkungen der Französischen Revolution selbst mit – und er erlebte auch mit, wie schnell sich selbst kluge und aufgeklärte Menschen radikalisierten, wenn sie nur zu heroischen Taten aufgestachelt wurden. Logisch, dass Metternich fortan mit anderen Augen auf die Revolution schaute. Erst recht, als der französische Kaiser dann begann, die Revolution mit seinen Armeen in die anderen Länder Europas zu exportieren.
Und die Niederlage Napoleons beendete das Zeitalter der Revolutionen nicht. Metternich wusste das. Und er war sich auch dessen bewusst, dass er eigentlich mit den Mitteln eines vergangenen Zeitalters versuchte, die Geburtswehen eines neuen Zeitalters zu unterdrücken. Das belegen mittlerweile etliche Schriften und Dokumente aus Metternichs Leben, die inzwischen ausgewertet wurden. Und die einen Mann zeigen, der ganz bestimmt nicht so verknöchert und illiberal war, wie ihn viele seiner Kritiker darstellen. Wobei das die spannendste Stelle an diesem Mann ist, der nicht nur hoch gebildet war, sondern auch im Geist der Aufklärung aufgewachsen.
Nur zog er aus den Schriften der Aufklärer andere Schlüsse – ganz seinem Amt und seinem Kaiser verpflichtet.
Wie bewahrt man eine Monarchie?
Denn ihm ging es natürlich um die Bewahrung der Habsburger Monarchie. Und die hatte nur eine Chance, wenn zwischen den dominanten Mächten des Kontinents so etwas wie eine vertragliche Balance ausgehandelt wurde. Das waren damals das habsburgische Österreich, Preußen, Russland, England und natürlich das besiegte Frankreich. Doch statt es dafür zu bestrafen, holte man Frankreich mit an den Tisch und band es ein in die neue Friedensordnung. Denn eins wusste Metternich: Wer ein besiegtes Land auch noch zum Buhmann macht, der schafft den nächsten Kriegsgrund.
Und Siemann schildert sehr plastisch, wie der geschmeidige Metternich sich bei all diesen Verhandlungen als Person immer zurücknahm. Ihm waren klug ausgehandelte Verträge wichtiger als die Durchsetzung unerfüllbarer Wünsche. Und am schwersten war es, zwei Siegermächte zu befriedigen, die ihre Rolle als Teil der siegreichen Allianz auch mit dem Anspruch verbanden, sich jetzt ordentlich Siegesbeute einheimsen zu können – Preußen und Russland. Zu leiden hatten darunter die Polen und – durch Metternich deutlich abgemildert – auch die Sachsen.
Wobei dem besiegten Sachsen, das bis zur Völkerschlacht 1813 an der Seite Napoleons ausharrte, wohl zugutekam, dass Metternich 1802 seine diplomatische Laufbahn in Dresden begonnen hatte.
Die schwere Kunst der Diplomatie
Von welchen Prinzipien sich Metternich leiten ließ, das schildert in diesem Band einer der bekanntesten Außenpolitiker des 20. Jahrhunderts – Henry Kissinger. Sein Beitrag endet mit der bemerkenswerten Feststellung: „Denn Staatsmänner darf man nicht nur an ihren Taten, sondern auch an ihren Vorstellungen über Alternativen messen.“
Eine Erkenntnis, die vielen (Außen-)Politikern abgeht. Sie sind nicht fähig, in möglichen gangbaren Alternativen zu denken. Sie poltern lieber, setzen stur ihre Programme um, nehmen Worte in den Mund wie „alternativlos“ und sind auch noch stolz auf ihre politische Blindheit. Kissingers Beitrag liest sich im Grunde wie eine kleine Handreichung für Diplomaten, die wirklich etwas erreichen wollen. Die sich selbst nicht so wichtig nehmen, immer die Form wahren, auch mit politischen Gegnern reden – und überhaupt reden. Denn das ist ja das zentrale Moment des Wiener Kongresses.
Wolfram Siemann geht ja genau darauf ein, was diesen Kongress zu einem Novum machte und zu einem Modell, das bis in die Gegenwart als vorbildlich gilt.
Denn Kongresse dieser Art gab es vorher nicht. Die gekrönten Häupter Europas korrespondierten meist nur miteinander oder sandten Boten aus. Dass sie sich alle über acht Monate zu einem Kongress trafen und leibhaftig am Kaffeetisch gegenüber saßen, das war neu. Sie mussten sich in die Augen blicken. Und wo sie ihre Wünsche, Forderungen und Schwerenöte hatten, da sorgten Kommissionen dafür, dass diese schon vor der Unterzeichnung durch die honorigen Herren vertraglich eingehegt und befriedet waren.
Man sieht sehr wohl, dass das ein Modell für eine neue Zeit war, das funktionieren konnte – wenn es Männer wie Metternich gab.
Das Aufkommen des Nationalismus
Aber er sah auch, wie gerade in dieser Zeit auch der Nationalismus aufkam, jene zwiespältige Begleiterscheinung der neuen bürgerlichen Gesellschaft. Die alten Klammern der Gesellschaft – Adel und Papsttum – verloren ihr Bindungskraft. Und auch der Versuch des russischen Zaren, mit der Heiligen Allianz eine Art „wertebasierte Außenpolitik“ zu begründen, scheiterte. Auch wenn der Stuttgarter Historiker Wolfram Pyta versucht, dieser – christlichen – Wertsetzung in der Politik etwas Positives abzugewinnen.
Aber diese von Zar Alexander I. initiierte Heilige Allianz war noch viel mehr aus der Zeit gefallen als Metternichs Politik. Das „Gottesgnadentum der Herrscher“ und „die christliche Religion als Fundament der herrschenden politischen Ordnung“ (Wikipedia) wurden von den Bürgern Europas als genau das empfunden, was sie auch waren: Gerümpel aus der Klamottenkiste.
Es war eben nicht Metternich, der Europa dann den reaktionären Fahrplan verpasste, für den er oft verantwortlich gemacht wird, sondern die sich nun ihrer Throne wieder sicheren Herren der Heiligen Allianz, die mit den Karlsbader Beschlüssen genau jene Stimmung befeuerten, die in Europa bald ein ganzes Lauffeuer an Revolutionen erzeugen würde.
Wobei Siemann auch die Zerrissenheit Metternichs beschreibt, der sehr wohl wusste, dass bürgerliche Reformen auch im Habsburgischen Kaiserreich überfällig waren. Aber dann doch davor zurückschreckte, weil er nicht zu überschauen vermochte, was daraus werden würde. Wozu natürlich noch die Tatsache kommt, dass Metternich zumeist gar nicht für die österreichische Innenpolitik zuständig war. Da tummelte sich ein wirklich reaktionärer Adliger namens Kolowrat-Liebsteinsky.
Die Balance der fünf Großmächte
So betrachtet war Metternich ein Politiker des Übergangs, der mit der Haltung eines Adligen aus dem 18. Jahrhundert und neuen diplomatischen Mitteln dem von Kriegen ermüdeten Europa eine Atempause des Friedens verschaffte. Mit den Worten von Wolfram Siemann: „Man kann das Werk des Wiener Kongresses als das Ergebnis einer neuartigen, modern operierenden Spitzendiplomatie betrachten.“
Metternich war es am wichtigsten, dass in Europa wieder ein gut austariertes Mächtegleichgewicht entstand, in dem sich vor allem die fünf Großmächte gegenseitig in Schach hielten und gleichzeitig die Interessen der kleineren Länder gewahrt blieben. Was insbesondere für Deutschland wichtig war, denn damit wurde im Grunde der deutsche Föderalismus gestärkt und mit dem Deutschen Bund ein neues Konstrukt geschaffen, welches das sang- und klanglos aufgelöste Heilige Römische Reich Deutscher Nation beerbte.
Genau dieser Föderalismus wirkt – man denke nur an den damaligen Aufsteiger Bayern – bis heute fort.
Gibt das Buch Metternich also eine neue Position in der Geschichtsschreibung, wertet vielleicht gar sein Wirken neu? Das nicht unbedingt.
Aber es macht in mehreren Beiträgen deutlich, dass Friedensstiftung nichts mit „Werten“ oder „Missionen“ zu tun hat, sondern mit richtig dickfelliger diplomatischer Arbeit, die versucht, wirklich alle Betroffenen an einen Tisch zu bekommen und eine tragfähige Vertragskonstruktion für das Miteinander zu erarbeiten. Was aber eben nicht ausschließt, dass ein nur von Eigeninteressen geleiteter Machthaber ausschert, das ganze System zerfetzt und wieder zum alten Mittel der puren Gewalt, dem Krieg, greift.
Der Irrglaube an absolute Sicherheit
Eine Gefahr, die auch Kissinger sieht, wenn er – direkt auf unsere Gegenwart bezogen – schreibt: „Gefangen von der Erinnerung an die langjährige Stabilität, neigen Staaten dann dazu, ihre Sicherheit durch Nichtstun zu erreichen, und Ohnmacht mit Mangel an Provokation zu verwechseln. Der Eroberer soll durch Vernunft oder vielleicht Zusammenarbeit gezähmt werden, kurz, durch eine Politik, die sich tödliche Bedrohung oder totale Vernichtung gar nicht vorstellen kann.“
Was eben auch bedeutet: Ein solches Friedenssystem ist auf Vertrauen aufgebaut. „Da absolute Sicherheit für einen Staat absolute Unsicherheit für alle anderen bedeutet, ist absolute Sicherheit niemals als Ziel einer ‚legitimen‘ Regelung zu erreichen, sondern nur auf dem Weg über Eroberungen“, schreibt Kissinger. Und beschreibt damit die Denkfalle, in die alle Eroberer in den vergangenen zwei Jahrhunderten immer wieder gelaufen sind. Mit verheerenden Kriegen als Folge.
Und da wird dieses mit durch und durch konservativen Motiven gebaute Friedenssystem des Wiener Kongresses auf einmal gegenwärtig und modern. Und mit ihm dieser Klemens Wenzel Lothar von Metternich, der vielleicht gerade deshalb, weil er im Denken genauso konservativ war wie die Fürsten seiner Zeit, ihnen ein solches Friedensprojekt aufs Auge drücken konnte. Wohl wissend, dass es nur für eine gewisse Zeit funktionieren würde.
Stefan Samerski (Hrsg.) „Metternich und der europäische Frieden“, Mitteldeutscher Verlag, Halle 2023, 20 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
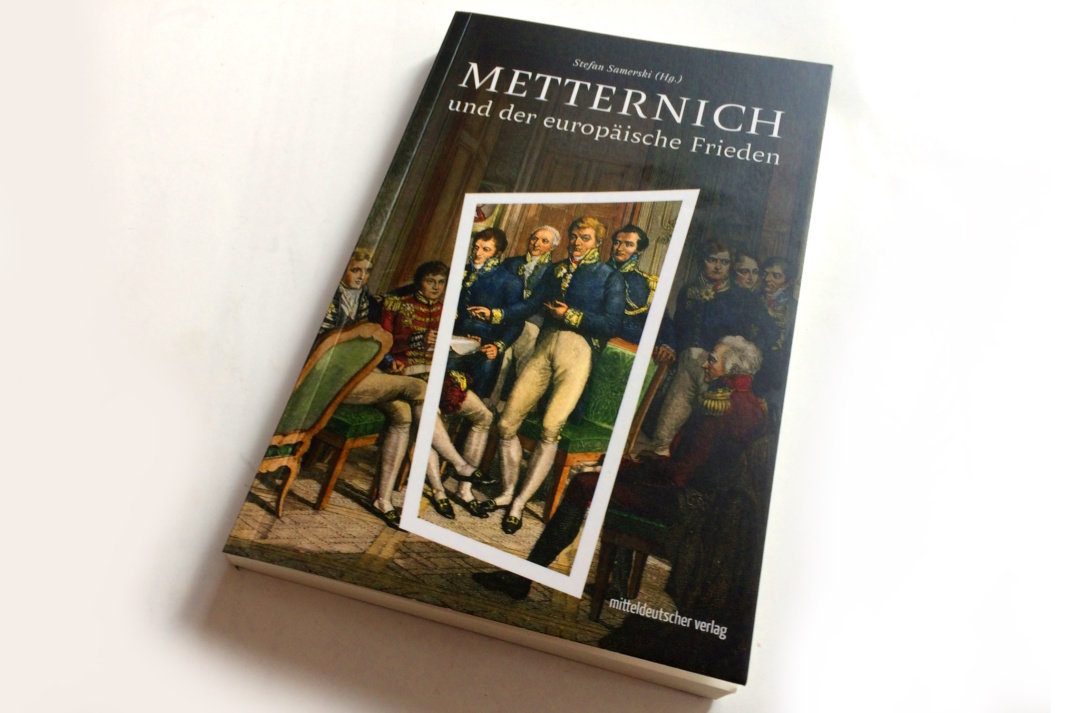






















Keine Kommentare bisher