Autoren finden beim Schreiben oft Dinge, die sie gar nicht gesucht haben. Manche wissen das, dass es ein unabhängiges, ganz und gar bewusstes Schreiben nicht gibt. Und dass ein Autor auch nicht dagegen anarbeiten kann. Das eigene Leben, Denken und Fühlen schreibt sich mit in den Text hinein, ob das einer nun will oder nicht. Das darf man nicht nur gegen Autoren ins Feld fühlen. Denn das betrifft alle, die öffentlich werden. Nur dass Schriftsteller mit diesen Texten ihren Lesen auch immer etwas schenken. Ungewollt gewollt. Davon lebt Literatur.
Davon leben auch die kurzen Geschichten Holger Uskes, der in seinem Arbeitsleben erst als Ingenieur unterwegs war, von 1990 bis 2018 dann als Pressearbeiter in Suhl. Er ist auch Lyriker, Erzähler und Liedermacher. Er bevorzugt die kleinen Formen. In diesem Fall Prosatexte, die in ihrer Kürze und Lakonie an Texte diverser Autoren des Surrealismus erinnern – an Kubin, Meyrink, Kafka. Auch das Weltgefühl scheint er zu teilen. Das „Unbehagen in der Kultur“, das Sigmund Freud 1930 versuchte, in Worte zu fassen.
Man muss nicht den ganzen Freud lesen, um eine ganz zentrale Gestalt dieser Literaturepoche zu finden – den In-der-Welt-Verlorenen, dem die Dinge zustoßen, der aber keinen Platz findet in dieser Welt, sich eher ausgeschlossen fühlt, völlig auf sich selbst verwiesen. Und letztlich machtlos den Ereignissen gegenüber, die er nicht zu beeinflussen vermag. Und so wird er zum Strandgut, zum Ausgesetzten. Eben zu einer kafkaesken Gestalt.
Und zur Wahrheit gehört: Was Freud & Co. seinerzeit für den in der modernen Welt verloren gegangenen Menschen diagnostizierten, gilt auch rund 100 Jahre später immer noch. Nur dass es die einen so empfinden – als pure Machtlosigkeit dem eigenen Schicksal gegenüber. Und andere versuchen es in Worte und kleine Prosatexte zu fassen.
Weil es sie dazu drängt. So wie Uske, der immer wieder zu Textformen wie Parabel und Groteske greift. Zu Traum-Geschichten, wie sie jüngst auch Manfred Jendryschik veröffentlichte. Das Leben als Traum, könnte man à la Shakespeare sagen. Aber darum geht es nicht. Es geht eher um Bilder für das Nicht-Fassbare in einem Leben, in dem der Erzähler sich geradezu selbst beobachtet und so etwas wie der Gregor Samsa seines eigenen Daseins wird.
Distanzierte Beziehungen
Und das noch viel stärker in den kurzen Geschichten, in denen die Wirklichkeit einbricht in sein Erzählen – ein ehemaliger Stasi-Mitarbeiter, der den einst Observierten nun die besten Fotos aus der heimlichen Beobachtung verkaufen will („Alte Bilder“) oder wenn die Bedrohung durch gewalttätige Nazis direkt vor der Tür steht („Verfolgt“). Es sind Geschichten aus der Einsamkeit. Die Erzähler stehen den Figuren, die ihnen begegnen, stets allein gegenüber.
Selbst die Beziehungen zu Frauen sind distanziert, geradezu voller Misstrauen, als ginge von ihnen stets die Gefahr aus, sie könnten sich unerwartet verhalten. Oder den Beobachter gar zur Rede stellen. Der durchaus ein schlechtes Gewissen hat, tief eingepflanzt ins eigene Denken.
Als würden die Figuren, die aus der Ich-Perspektive erzählen, die Welt immer durch eine Glasscheibe betrachten, verstört, verunsichert, immerfort auf der Hut. Denn ein Fehler könnte genügen, und seltsame Dinge passieren, ein Unheil bricht durch, Seltsames geschieht wie in der kleinen Stadt, in der beim Heimweg von der Arbeit auf einmal alles stehenzubleiben scheint, als wäre die Welt aus dem Takt geraten („Der langsame Lauf“).
Dass das möglicherweise mit einer tatsächlich aufs falsche Gleis geratenen Gesellschaft zu tun haben könnte, deutet Uske an, wenn er in „Nathan“ eine dieser beklemmenden Atmosphären in irgendeinem Unternehmen oder Institut schildert, in denen ein falsches Wort am falschen Platz genügt, dass einer bloßgestellt und schikaniert wird. Zum kleinen Käfer gemacht wird, der sich sofort duckt, weil er nicht wirklich teil hat „am Volksempfinden“, irgendwie falsch ist, nicht auf Linie, nicht angepasst genug. Ein störender Mensch.
Fragile Existenzen
Das Verstörtsein als Lebenserfahrung, das sich über die Zeiten immer wieder reproduziert. Weil scheinbar immer wieder Leute Macht haben da draußen, die dem Schwächeren nicht das Recht zugestehen, ganz und gar da zu sein. Sondern alles an Fügsamkeit und Eingepasstheit binden. Was dann bei diesen armen Figuren natürlich das andauernde Gefühl ergibt, immer nur an der Schwelle zur Wirklichkeit zu stehen, nicht richtig da zu sein. Das Leben als Kulisse und Traum. Immer gefährdet durch eine falsche Geste, ein falsches Wort.
Da fühlt sich dann einer wie Pilatus, der seit 2.000 Jahren darauf wartet, dass jemand ihm zugesteht, vielleicht doch aus gutem Willen gehandelt zu haben („Eine andere Geschichte“). Oder wie Goldberg, der seine Geliebte nicht heiraten darf, weil er noch kein Einkommen hat – und den berühmten Herrn Bach im Grunde nur beiläufig wahrnimmt („Herr Goldberg träumt“). Eine verpasste Chance. Aber irgendwie auch das Leben, das einen immerfort mit Sorgen darum beschäftigt, wie man doch noch seine Wünsche erfüllt bekommt.
Und dann gründlich scheitert, ohne zu wissen, warum. So wie in „Ende einer Expedition“, in der nicht nur die Geliebte verschwindet, sondern die ganze Existenz des Erzählers sich in Nichts auflöst. Ausgelöscht wie eine störende Datei. Im Grunde geht es in fast jeder Geschichte um diese Distanz, die Furcht des Zuschauers davor, dass die Wirklichkeit sich als tatsächlich unverlässlich erweist. Da bleibt vielleicht noch Raum für eine tastende Annäherung zweier Einsamer („Ich kauf ihm das Schiff“) oder eine überraschende Begegnung an der Landstraße („Schräglage“).
Doch auch hier bleibt das Erzählen distanziert, wird die junge Frau, die der Motorradfahrer mitnimmt, nicht wirklich greifbar, entsteht kein mit Leben erfülltes Bild. Auch weil wieder das Grübeln dazwischenkommt, wie in fast jeder Geschichte. Der Erzählende wird nie wirklich Teil der Geschichte, sondern bleibt auf Distanz – als Zuschauer, Beurteiler, Zagender. Denn es könnte ja schiefgehen.
Eine Erzählposition, die manchem Leser nicht fremd sein dürfte. Denn das alles ist anerzogen. Es ist die Schule einer Zivilisation, die ihre Mitglieder erzieht zum permanenten Acht-Geben – auf sich und andere.
Fremd in der Welt
Woher kommt das? Der Erzählstil wirkt vertraut. Und ist auch so alt nicht. Manchmal trocken, auf Verben oft verzichtend. Eine Erzählweise, die für ostdeutsche Erzähler oft geradezu typisch ist, geboren aus dem Versuch, das Sprechen des Volkes nachzuvollziehen, den des Sprechens nur mühsam Fähigen doch noch zum Erzähler zu machen, sein stockendes, Eindruck an Eindruck kettendes Sprechen. Als würden aus solchen Brocken dann Sätze werden, Bilder, die der Leser im Kopf zusammensetzen kann.
Ein Versuch, das assoziative Denken nachzuvollziehen. „Der Raum wieder, jener Saal auf einmal, mein anderer Tag. Noch immer die Sonne vorm Fenster, aber die Blätter beginnen sich zu färben.“ („Herr Goldberg träumt“) Eine Erzählweise, die die Distanz verstärkt, die nicht nur der Erzähler zum Geschilderten hat.
Und die die Zeit versiegen lässt, das Geschilderte zum statischen Eindruck gerinnen lässt. Das Erzählen verstärkt das Grundgefühl, dass Leben nicht geschieht.
Und auch das mutet gegenwärtig an. Denn nicht nur sprechen viel zu viele Zeitgenossen so gebrochen, als würden sie die Dinge, die ihnen geschehen, nicht mehr in eine erzählbare Geschichte bringen können. Sie verhalten sich auch so. Die Wirklichkeit ist zu einem unzuverlässigen Stoff geworden, dem man mit Vorsicht und einer gewissen Furcht begegnet. Auch das eine Form des Außer-sich-Seins.
Das zwangsläufig auch zu einer Variante der erlebten Einsamkeit wird. Denn wenn man der Welt nicht mehr vertrauen kann, weil sie sich als brüchig und unfassbar zeigt, dann geht man wie ein Fremder durchs eigene Leben. Genauso wie die Ich-Erzähler in Uskes Geschichten, die schon deshalb keine Erzählungen werden. Denn um zur Erzählung zu werden, muss der Stoff des Lebens fließen, muss man sich darin aufgehoben und lebendig fühlen.
Jedes Wort auf der Goldwaage
Am Leben fühlt man erst, wenn man sich nicht nur als Gast und immer nur Fremder empfindet, der eher damit zu tun hat, alles zu vermeiden, was ihn selbst betreffen könnte. Distanziert wie die Marionette in „Draußen“, gleich der ersten Geschichte in diesem Band. „Er geht noch umher als ein Fremder. Die Welt, so neu, so unentdeckt, zeigt sich ihm in trockenen Schollen am Boden, in knorrigen Bäumen, harten Gräsern und ein paar blassen Blüten daran. Zu denen er nicht schaut. Er schaut nirgendwohin.“
Die Geschichte steht wie ein Schlüssel für alle folgenden. Weil sie auch den Akt des Sprechens thematisiert. „Er muss, redet sich der Junge zu, er muss vielleicht die Worte erst auf der Zunge prüfen, bevor er sie entlässt.“
Wann gibt man sich preis, wenn man spricht? Was gibt man von sich preis? Und wie schnell wird einem das zum Verhängnis, wenn man doch gelernt hat, jedes Wort auf die Goldwaage zu legen, den Mund zu halten, wenn andere reden, sich nicht vorzudrängen. Also schön unauffällig zu bleiben. Eine sehr ostdeutsche Position. Denn wer sich vordrängt, bringt sich in Gefahr. Wer den Schritt aber nicht wagt, bleibt Außenseiter im eigenen Leben. Erlebt es wie einen Traum. Nur, dass es irgendwie nicht sein eigener ist. Kafka lässt grüßen.
Holger Uske „Stunden-Tanz“, Dr. Ziethen Verlag, Oschersleben 2025, 15 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
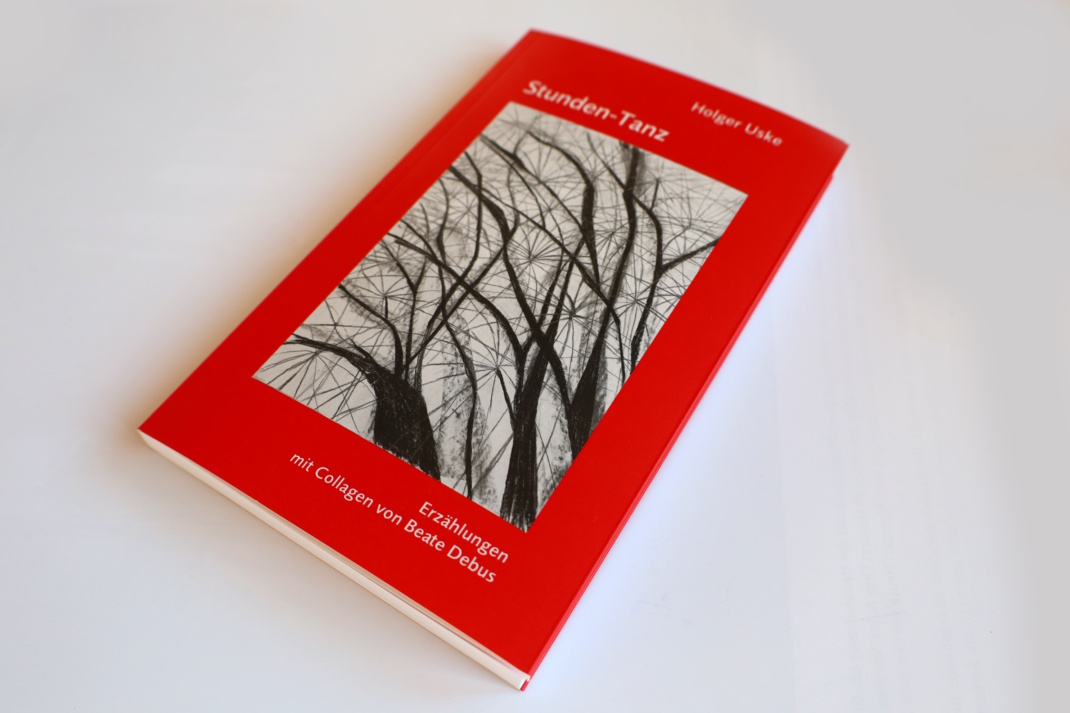




















Keine Kommentare bisher