Es gibt wohl über kein deutsches Magazin derzeit so eine Erfolgsgeschichte zu erzählen wie über das Katapult Magazin. Es hat mit einer Tugend die Herzen seiner Leser/-innen erobert, die so manche deutsche (Tages-)Zeitung längst vergessen hat auf der Jagd nach Klicks und Reichweite: Die Liebe zu Zahlen, Fakten und einprägsamen Grafiken, die den Leser/-innen bildhaft vor Augen führten, wie die Welt ist. Wie sie wirklich ist. Natürlich ergibt so etwas Ärger.
Denn damit eckt man an in einer Medienlandschaft, in der einige große Konzerne den Ton angeben und glauben, sie könnten die Marktbedingungen selbst bestimmen, wie das 60 Jahre lang üblich und möglich war. Mit einigen ist der kleine Katapult Verlag seit der Magazin-Gründung 2015 zusammengerasselt, hat öffentlich den heftigen Streit ausgetragen, den die Juristen der großen Verlagshäuser gern hinter verschlossenen Türen vor Gericht ausgetragen hätten.Aber für solche Spielchen ist Benjamin Fredrich, der Magazingründer, nicht der Typ. Wahrscheinlich schon von Kindesbeinen an, zumindest deutete sich so etwas an in seinem ersten Buch „Die Redaktion“, in dem er die Gründung des Katapult-Magazins als flotte Eulenspiegel-Geschichte erzählt. Die es natürlich auch war.
Wer in dem unter neuerungsunwilligen deutschen Regierungen bräsig und phlegmatisch gewordenen Deutschland ein neues Unternehmen, gar in der Medienbranche, gründet, der weiß, wie sehr man es mit dem Unglauben und Unverständnis einer Gesellschaft zu tun bekommt, die sich mit der Rolle eines unabhängigen Journalismus in der Demokratie nie wirklich ernsthaft beschäftigt hat.
Wenn Editorials wirklich mal Tacheles reden
Und auch wenn der Titel seines zweiten Buches so klingt, als wäre es die Fortsetzung seiner romanhaft erzählten Gründungsgeschichte, ist es etwas, was es in dieser Form sehr selten auf dem deutschen Buchmarkt gibt. Im Grunde sind es die gesammelten Editorials von Heft Nr. 1, das im April 2016 erschien, bis zum Heft Nr. 23, das im Oktober 2021 erschien.
Und Fredrichs Editorials haben es in sich, auch wenn die ersten natürlich davon erzählen, dass auch Fredrich das Editorial-Schreiben erst lernen musste. Denn wie spricht man als Chefredakteur zu seinen Leser/-innen, ohne sie direkt vor sich sitzen zu haben? Was erzählt man ihnen? Was traut man sich zu erzählen?
Es hat ein paar Ausgaben gebraucht, aber dann entdeckte Fredrich die Stärke des Editorials, das eben nicht nur als Ansprache ans Publikum funktioniert oder als schöner Ort, wo man über die eigenen Projekte, Ideen und Pläne erzählen und die Leser/-innen zum Mitmachen einladen kann. Hier darf man auch den Streit suchen und den Kampf aufnehmen.
Eine fast vergessene Tugend in deutschen Blätterwäldern, wo man ungern über sich selbst, sein Tun und seine Branche schreibt. Oder gar den Ärger, den man mit anderen Leuten aus der Branche hat. Ärger, den das Katapult-Team ziemlich schnell erlebte, als sich herausstellte, dass seine Herangehensweise an einen von Wissenschaft und Fakten basierten Stil der Darstellung bei gebildeten Leser/-innen Anklang fand.
Es braucht klugen Lokaljournalismus gegen die Feinde der Demokratie
Bei dem ganzen Gelärme auf der Straße haben wir zwar den vorherrschenden Eindruck, dass die Gegenaufklärung auf dem Vormarsch ist und mit dem ganzen Gebimmel von „Fakenews“, „Lügenpresse“ und „Meinungsfreiheit“ alle rationalen Errungenschaften des wissenschaftlichen Zeitalters wieder obsolet werden, ersetzt durch „Meinungen“, Mythen und Verschwörungstheorien.
Aber wahrscheinlich sollte man die Perspektive ändern und auch einmal akzeptieren, dass sowohl die sogenannten „social media“-Plattformen mit ihren von wilden Emotionen getriebenen Algorithmen auf dem Holzweg sind, als auch die meisten „klassischen“ Medien, die alle Schleusen für Volkes Zorn und Wüten öffnen, damit aber letztlich einer Minderheit die mediale Hoheit und Aufmerksamkeit verschaffen, die es schon immer gab – wissenschaftsfeindlich, ignorant, rassistisch, aggressiv und eingebildet. Die aber immer die wütende Position einer radikalen Minderheit war.
Denn da hilft augenscheinlich das, was wir als Schulbildung haben, nicht weiter: Ein Teil unserer Gesellschaft geht ohne jegliche Grundkenntnisse logischen und rationalen Denkens aus der Schule ab, kann Fakten nicht von Lügen unterscheiden und geht jedem Märchenerzähler auf den Leim, der ihm nur suggeriert, dass irgendwelche unsichtbaren Mächte die Welt steuern …
Wie wehrt man sich gegen die Elefanten?
Obwohl es da draußen nur genauso zugeht wie auf jedem „liberalisierten“ Markt. Wer glaubt, zu den Big Playern zu gehörten, hebelt Regeln und Gesetze aus, benimmt sich wie der Elefant im Porzellanladen und geht mit den Kleinen um, als wären das nur lausige Straßenköter.
Und wenn die mal eine gute Idee haben, wird eben einfach geklaut und abgekupfert. Was durchaus zu einer Leidensgeschichte im Hause Katapult hätte führen können. Denn wie wehrt man sich gegen große Verlagskonzerne, wenn die einfach glauben, Ideen einfach abkupfern und damit die fette Kohle machen zu können?
Reichen da ein paar Anrufe, die meist bei freundlichen Menschen landen? Oder eine juristische Note vom teuer bezahlten Rechtsanwalt? Irgendwann spielte Fredrich nicht nur mit dem Gedanken, sein Editorial mit „Fredrich rastet aus“ zu überschreiben – er tat es auch. Und er erzählte dort all das, was hinter den Kulissen geschah und was die bekannten großen deutschen Verlage auf ihren Websites und in ihren Printprodukten nie erzählen.
Denn so ein bisschen ist die Erinnerung doch noch wach, dass das Öffentlichmachen von solchen Vorgängen doch eine enorme Wirkung hat. Im Zeitalter von Kommentarfunktionen sowieso. Denn Leser/-innen – und gerade die von klugen und transparent arbeitenden Medien – wissen, wo der Spaß aufhört, wann sie es mit Lug und Trug und dreisten Kopien zu tun haben.
Und sie haben auch keine Angst mehr vor den großen Namen. Und Fredrich nannte sie alle beim Namen, die glaubten, auf Kosten von Katapult nun eigene Geschäfte machen zu können, weil das diese Katapult-Leute doch so toll machten.
Und da bekam es auch Fredrich mit seltsamen Argumenten zu tun, in denen Quellen und Ideen einfach mal verwechselt wurden und Verlagsvertreter auf einmal von „Schöpfungshöhen“ anfingen zu schwafeln, weil sie die Lizenz zur Übernahme kreativer Arbeit einfach für nass haben wollten.
Wenn Lokalblätter dem Rassismus ihre Spalten öffnen
Und nicht nur diese Kämpfe erzählt Fredrich, die auch dazu geführt haben, dass Katapult auch gut angelaufene Kooperationen beendete und sich 2020 entschloss, auch noch einen eigenen Buchverlag zu gründen, um die eigenen Bücher auch selbst zu verlegen – so wie dieses hier.
Fredrich erzählt auch, wie all die anderen Ideen auf die Beine kamen, die das längst nicht mehr kleine Verlagshaus in Greifswald auf die Beine stellte – vom Pflanzen eines eigenen Waldes über den Kauf eines alten Schulgebäudes, das zu einem neuen Verlagsgebäude ausgebaut wird und künftig ein Café und auch eine Journalistenschule beherbergen soll.
Denn zwischendurch hat Katapult auch den Kampf gegen den wild gewordenen Lokaljournalismus an der Waterkant aufgenommen, speziell gegen die Blattpolitik des „Nordkurier“, die nicht nur dem Rassismus in den Kommentarspalten freien Lauf ließ, sondern diesen mit entsprechenden Artikeln und Überschriften auch noch selbst befeuerte.
Ein Journalismus, den längst auch andere Regionen von ihren Regionalzeitungen kennen, die – im Angesicht schwindender Abonnentenzahlen und Auflagen – regelrecht verzweifelt auf rassistische Stereotype setzen, um irgendwie die Nutzerzahlen hochzutreiben.
Was dabei wirklich auf der Strecke bleibt, ist der eigentliche Lokaljournalismus, der über all das berichtet, worüber sonst niemand berichten würde, all die Dinge in der Region, die aufregend, wichtig oder auch besonders sind. Und aus denen letztlich die Lebenswelt der Leser/-innen besteht.
Ergebnis: Katapult hat mit katapult-mv.de auch gleich mal eine eigene Regionalzeitung gegründet und will – wissend um die elementare Rolle des Regionaljournalismus für die Demokratie – noch weitere solche Zeitungen gründen und Lokalredakteure ausbilden.
Auch ein paar rechte Anwälte im Angebot
Und auch wenn Fredrich immer wieder gern betont, dass all das, was sich Katapult vornimmt, wohl doch eher verrückt ist und keiner weiß, ob es am Ende gutgeht, haben die bislang umgesetzten Projekte alle funktioniert. Überraschenderweise auch für Benjamin Fredrich, der im Vorspann einen kleinen Einblick gibt in die teils ziemlich dummen Ideen, mit denen er vorher schon mal versucht hatte, Geld zu verdienen.
Aber er stellt seine Editorials nicht kommentarlos ins Buch, sondern ergänzt sie mit den jüngeren Erkenntnissen, wie am Ende all das ausging – der Streit etwa mit Übermedien, wo man Fredrich mit seinem ersten Buch an den Pranger stellen wollte. Oder den Ärger mit den rechtsradikalen Anwälten rechter Abgeordneter, die auch bei Katapult ihre Masche mit Abmahnung und leichter Anwaltsdrohung durchziehen wollten.
Und Fredrich hat recht: Mit der Methode gelingt es rechtsradikalen Anwälten durchaus, kritische Medien immer wieder mundtot zu machen, denn nicht alle haben das Geld, um einen eigenen Anwalt zu bezahlen und Abmahngebühren zu begleichen.
Wer wirklich Medien macht in Deutschland, dem kommt vieles in diesem Buch sehr vertraut vor. Und gleichzeitig zeigt einem dieser Fredrich, dass es keinen besseren Schutz für kritischen Journalismus gibt als die Öffentlichkeit und ein transparentes Arbeiten. Denn von den „Kollegen“ in der Branche braucht man nichts zu erwarten.
Schon gar nicht im Lokaljournalismus, wo sich eine Handvoll großer Zeitungskonzerne vor Jahrzehnten „den Markt aufgeteilt“ haben. Mit dem Ergebnis eines bräsigen und letztlich stockkonservativen Berichterstattens, das alle wirklichen Tugenden des Reports vergessen zu haben scheint.
Übernimmst du dich da nicht, Junge?
Für Katapult-Leser ist das Buch wie eine komprimierte Reise durch fünf wilde Jahre. Wer den Katapult-Kosmos noch nicht kennt, lernt ihn hier kennen und erfährt dabei auch, warum sich ein „ausgerasteter“ Fredrich wohltuend von der Berichterstattung anderer Medien über ihre Arbeitspraxis unterscheidet. Und auch, warum Fredrich einen der Medienpreise Deutschlands einfach deshalb abgelehnt hat, weil ihn auch ein Blatt des Springer-Konzerns bekommen hat.
Was als Fazit stehen sollte, hat Fredrich freilich gleich in die Einleitung geschrieben, wo er über den Spruch nachdenkt, den er immer wieder zu hören bekommen hat: „Jetzt übernimmst du dich aber, Benni!“ Wir leben ja immer noch in Deutschland, wo haufenweise Leute ausgebildet werden, die einem alle naselang sagen, dass das, was man vorhat, viel zu riskant sei, dass man dabei auf die Nase fallen kann und dann mit der Niederlage fürs Leben gezeichnet ist.
Ja, das beschreibt Deutschland derzeit ganz gut: Diese vorweggenommene Häme, wenn einer sich nicht nur zu viel vornimmt, sondern überhaupt etwas, was man eigentlich nicht tun würde. Nicht in einem Land, das schon den Schulkindern jedes Risiko und jeden Wagemut auszureden versucht.
Mit dem Ergebnis, dass wir ein Land voller Schwarzmaler, Unken und „Hab ich‘s nicht gesagt“-Sager haben, die nie aus ihrem Trantütenmodus herauskommen. Eines, in dem Projekte wie Katapult eher die Ausnahme sind und die Bestverdiener auch noch stolz darauf sind, wenn sie wie die freundliche Ex-Bundeskanzlerin ihr Leben lang nur auf Sicht fahren. Was kommt dabei heraus?
Gar nichts. Bestenfalls das Gefühl, dass gar nichts mehr geht und man am besten gleich hinterm Ofen bleibt, wenn einen mal eine Idee anspringt. Klappt ja sowieso nicht. Muss man sich ja anstrengen und was riskieren. Wer macht das denn noch?
Tja. Da erstaunt es dann nicht mehr, dass die Abonnentenzahlen fürs Katapult-Magazin steigen und Fredrich für seine ziemlich spontanen Ideen immer wieder Zuspruch und Rückenwind bekommt, sodass er sie noch schneller umsetzen kann, als er zuvor gedacht hat. Und natürlich ist das Buch ein kleines Resümee zu diesen ersten fünf Jahren, das einen Ausschnitt unserer Mediengegenwart zeigt, den man so deutlich meist nicht sieht.
Benjamin Fredrich Fredrich rastet aus, Katapult Verlag, Greifswald 2021, 15 Euro.
Hinweis der Redaktion in eigener Sache
Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten alle Artikel der letzten Jahre auf L-IZ.de zu entdecken. Über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall.
Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.
Vielen Dank dafür.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
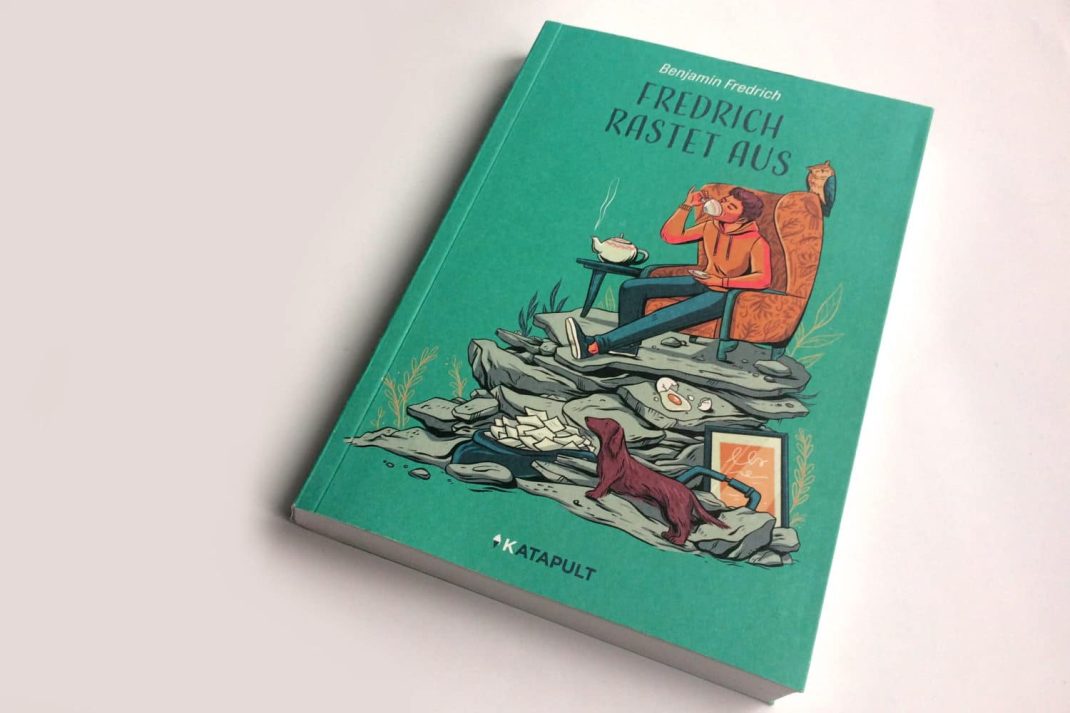




















Keine Kommentare bisher