Eigentlich sollte es anfangs nur ein Band werden, einer, der die verschiedene Stimmen von Dichterinnen und Dichtern aus dem deutschsprachigen Raum zusammenbringt und damit zeigt, welche Themen, Stimmungen und Gemeinsamkeiten Gegenwartsdichtung in deutscher Sprache aufweist. Auch Generationen und Regionen sollten vernetzt werden, wie Herausgeber Axel Kutsch betont, der nun das 15. Buch der Vernetzung vorgelegt hat.
Ordentlich sortiert nach Regionen, sodass man durchaus neugierig werden kann, ob sich tatsächlich Unterschiede ausmachen lassen. Denn dass dichtende Menschen in Ost und West, Nord und Süd oft gar nicht miteinander ins Gespräch kommen, liegt oft auch an regionalen Eigenarten, der Fixierung auf regionale Publikationsmöglichkeiten und oft auch lokale Dichternetzwerke.
Axel Kutschs Projekt erwies sich als so fruchtbar, dass er auch in den Folgejahren jeweils ein „Versnetze“ vorlegen konnte.
Es senden bekannte und unbekannte Autor/-innen ein. Und die Chance, unter den Ausgewählten zu sein, ist relativ hoch. Von rund 2.000 Einsendungen haben es über 300 in die Auswahl geschafft. Eine Auswahl, die natürlich subjektiv ist.
Aber Axel Kutsch ist selbst Lyriker, hat selbst schon mehrere Gedichtbände veröffentlicht und ist Herausgeber zahlreicher Gedichtanthologien, hat also ein gewisses Gefühl dafür, was neu, überraschend und ungewöhnlich genug ist, um in so einer Auswahl als für die Zeit typisch auftauchen zu können.
Und wer kocht dem Dichter den Kaffee?
Denn tatsächlich sind Dichterinnen und Dichter ja trotzdem vernetzt, auch wenn sie sonst gar nichts miteinander zu tun haben. Sie lesen ja selbst, was an Lyrik veröffentlicht wird – heutiges und klassisches. Ihre Lieblingsklassiker zitieren sie auch nur zu gern – Hölderlin taucht auf, Novalis, aber auch Goethe und ein Herr b. b. aus Augsburg.
Und man teilt die Themen der Zeit, selbst dann, wenn sich einige Autoren emsig bemühen, diesen Kalamitäten des Alltags aus dem Weg zu gehen. Sich also aufs ganz poetische Sein und Betrachten zu beschränken. Sage niemand, dass unsere Klassiker kein Unheil angerichtet haben.
Deswegen hat Kutsch natürlich recht, wenn er keiner Schule den Vorrang lässt, sondern das Klassische neben dem Modernen und Experimentellen stehen lässt, das zutiefst Philosophische neben dem höchst Ironischen und Spielerischen. Beweisen müssen sich die Texte sowieso vor den Augen der Leser.
Ihre Wirkung entfalten sie erst, wenn sie in den Lesenden etwas anklingen lassen. Auch wenn es ein bisschen viel an Einsamkeit, Verlassenheit, Herbst und Trauer ist bei einigen Texten. Also von jenem Stimmungskanon, den die Deutschen nach ihrer hausbackenen Romantik als „poetisch“ begreifen. Diese schreckliche Vergänglichkeit – man könnte sich aber auch wirklich aufregen.
Dass das auch Dichter aufregt, macht Bert Brune aus Bonn deutlich, der lakonisch feststellt, dass die meisten Dichter Frauen und Freundinnen haben, „die ihnen bei ihrem Schaffen helfen“. Doch „wenn man sich die Werke dieser Dichter ansieht / ihre Frauen, Freundinnen kommen da kaum vor …“
Die Echos der Kriege
Lauter einsame Genies. In Verlassenheit Schaffende, Fühlende, sich Sehnende. Was sich übrigens nicht nur auf die älteren Semester bezieht, die den Spaziergang im Wald zumindest noch zu genießen wissen, den Blätterfall und den Gesang der Vögel.
Auch viele Jüngere schreiben nur zu gern über ihre ganz besonderen Gefühle, freilich eher explosive und vulkanische, ganz so, als würde die schnöde Mitwelt nicht begreifen, was für ein Gebrodel da in ihnen wütet.
Worüber man nicht schimpfen darf. Es ist nur zu vertraut. Nur dass die alte Erlösungsformel, nach der zwei dann endlich zueinanderkommen konnten, nicht mehr zu funktionieren scheint.
Wahrscheinlich empfinden das Dichter und Dichterinnen nur deutlicher. Es sind ja nicht nur die Bäume, über die man nicht mehr so unbedarft dichten kann. Die historische Dimension ist durchaus vertreten, sogar erstaunlich reich.
Und das nicht nur bei den Ältesten, die das Nazireich noch als Kinder erlebt haben. Auch bei denen, die ihre Kinder und Enkel sein könnten und die über den alten Familienalben stutzen und der Frage, was der Großvater eigentlich erlebt hat. Und getan. Vielleicht.
Es ist ja wieder aktuell, da ein neuer Krieg überall die Frage aufwirft: Wie würdest du dich verhalten? Was würdest du tun? Auch wenn Kutsch betont, dass er etliche brave Texte zum Ukraine-Krieg lieber nicht übernommen hat.
Die, die es in den Band geschafft haben, sind nachdenklich. Sehr nachdenklich. Und spiegeln immer wieder auch unser eigenes Leben zurück. So wie in Renate Mödder-Reeses Gedicht „Zuviel“: „Vorteil des Wohlstands / und der Bequemlichkeit / macht uns vergessen / das Schlachten in der Welt / gleich nebenan …“
Landkarte der Verheißung
Wobei der Band keineswegs kriegslastig geriet. Was diverse Umfragen für diverse deutsche Medien immer wieder ergeben, stimmt zumindest für die Dichtenden und Schreibenden so gar nicht. Sie vergessen nicht einfach alles um sich herum, nur weil alle Kanäle voller Kriegsbilder sind.
Sie haben die Flut im Ahrtal vor einem Jahr nicht vergessen (so wie Andreas Noga aus Koblenz: „Nach der Flut“), nicht den Lockdown und die damit verbundenen Lebenserfahrungen, nicht den Plastikmüll in den Meeren oder die Obdachlosen draußen auf der Straße in ihren Kokons.
Mittendrin Dichter wie Franz Hodjak, der noch immer seine kleinen hinterlistigen Feststellungen über das Allzumenschliche macht („Es gehört inzwischen zum guten / Ton, dass man das, was man / nicht weiß, weitergibt …“) oder Thomas Böhme, der wie Hodjak die Flaschenpost für sich entdeckt („Eine Flaschenpost aus dem Meer / soll die Landkarte der Verheißung enthalten haben …“) oder Lutz Rathenow, der sich wieder freigeschrieben hat und über ein „erstes Kaffeetrinken im Freien“ unbändig freuen kann.
Vielleicht trügt es. Aber in den Gedichten derer aus den östlichen Postleitzahlbezirken kommt mehr Landschaft vor. Als gäbe es dort noch mehr davon. Oder als bekäme man doch noch mehr davon mit.
Landschaft, die immer wieder Schauplatz für menschliche Irritationen wird, wie bei Kai Pohl aus Berlin: „Auf einen Schlag ist der Himmel blau / Zwischen den Zweigen verkappter Hass / Wortfetzen unter Rädern / ein kurzes Wippen zum Schlachthaus-Blues.“
In Ordnung ist diese Landschaft jedenfalls nicht. Aber deutlich weniger deprimierend als Falk Andreas Funkes „Gott geht bankrott“. Auch wenn der Wuppertaler hier vor allem den Exodus aus der Kirche beschreibt. Zumindest funktionieren die alten Ausreden nicht mehr.
Was wir anrichten, müssen wir auch verantworten. Das nimmt uns keiner ab, auch wenn sich viele so benehmen wie der Mann in Rolf Polanders „Morgenzeitung“: „Du aber rührst ungerührt / in deiner Tasse / und köpfst mit dem Messer / dein Frühstücksei.“
Wir klimageschützten Reisenden
Die Spannweite, wie wir uns sorgen um die Welt, ist groß – von tiefster persönlicher Betroffenheit über scharfen Sarkasmus bis hin zum heroischen Warnruf. Alles ist dabei. Was entsteht, ist ein sehr vielstimmiges Gespräch.
Manchmal im Monolog, bei dem die Autoren wissen, dass die Lesenden eifrigst zuhören. Manchmal in einem verkappten „wir“, bei dem man nicht recht weiß, wer damit alles gemeint ist. Die Frau und Freundin meistens wohl nicht. Eher so ein poetisches Wir, das davon ausgeht, Dichtende wären eine große Gemeinschaft.
Sind sie aber nicht. Höchstens im Erschrockensein, so wie die beiden Autoren, die zufällig beide die französische Küste besucht haben und die alten Bunker des deutschen Westwalls verstörend aus dem Sand ragen sahen. „Mörderbeton an der Kante / und strahlende Kuppeln / werden versinken alle“, schreibt Ulrich Straeter in „Normandie“.
Womit sich der Kreis schließt. Denn die heutigen Kriege rufen die vergangenen wach, all das Kyklopische und Sinnlose daran, das sich auch mit Trauer nicht fassen lässt.
Während wir eigentlich ganz andere Sorgen haben, auch wenn wir so gern tun, als hätten wir sie nicht: „geht der airbag auf wenn wir uns / rammen wir reisen klimageschützt / und dreifach verriegelt unsere herzen / sind hohlraumversiegelt wir fühlen / computergestützt bei bedarf / frisieren wir uns politisch korrekt“. So schreibt es Pega Mund in „nichts neues : wir“.
Man spürt tatsächlich das Verstörende der Zeit in vielen dieser Texte, das, was nach Worten sucht, obwohl es nicht die finalen Worte über diese Zeit sein werden. Ein Netz eben aus Worten und Versen, das andere Töne und Klänge anschlägt, als sie im täglichen Nachrichtenrauschen zu hören sind.
Was auch die vielen Ichs erklärt: Dichter lassen sich noch treffen, sagen noch Ich, wenn etwas sie zutiefst verwirrt, verstört, ruhelos macht. Also raus, ins Offene, zu Brecht oder Hölderlin. Egal. Wer hört schon auf die Dichter, wenn man sich im klimatisierten Auto abschotten kann von allem, was wir angerichtet haben?
Dichterinnen gehen dann in den Wald und staunen: „Seltsam, denke ich, ohne Menschen / vereinen sich Frieden und Weisheit“, schreibt Barbara Zeitzinger in „Seltsame Tage“. Aber auch, um deutlich zu machen, dass es dazu gar keinen neuen Krieg brauchte: „April 2020“.
Das war die Lockdown-Zeit. Eine Zeit, die zumindest die Aufmerksamen dazu brachte, zu hören, wie laut es in ihnen selbst die ganze Zeit war – davor. Und danach gleich wieder.
Axel Kutsch Versnetze_15 Verlag Ralf Liebe, Weilerswist 2022, 25 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
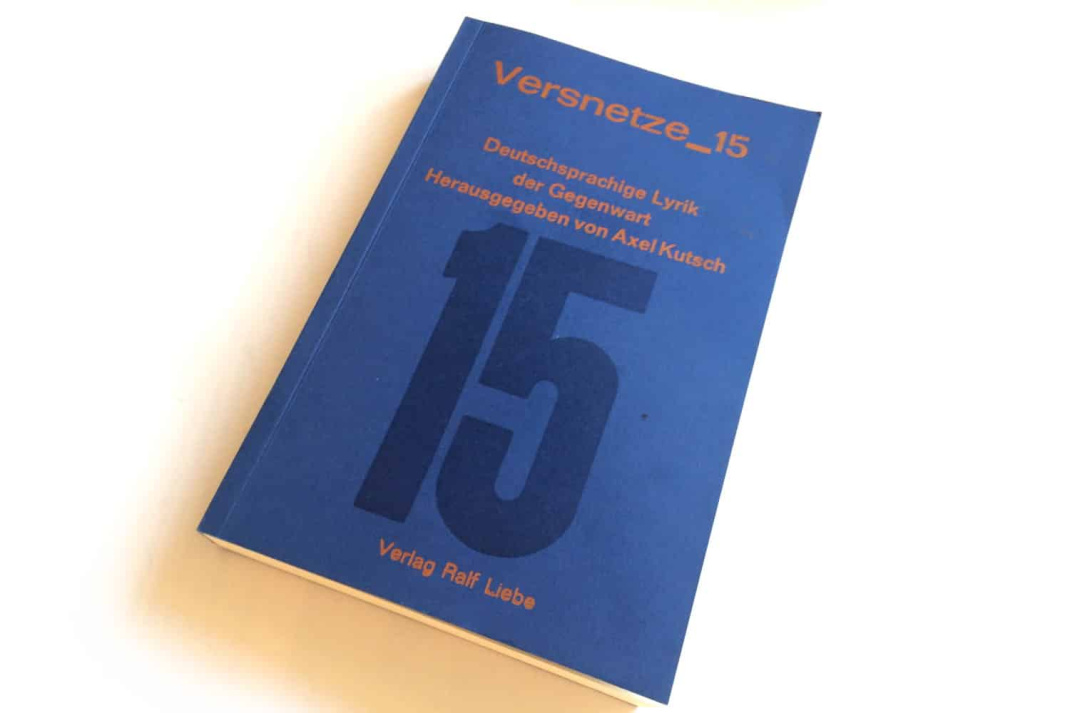




















Keine Kommentare bisher