Das vergangene Jahr hat auch den ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck sehr nachdenklich gemacht. Denn auch wenn er – anders als andere Politiker – deutlicher gesehen hat, welche Bedrohung das zunehmend aggressiver auftretende Russland für seine Nachbarn darstellte, war auch er erschüttert darüber, als der russische Präsident im Februar 2022 seine Truppen in die Ukraine einfallen ließ.
Doch er tut nicht so, als hätte er das so kommen sehen. Denn dass er den Wunsch der meisten Deutschen teilte, dass in Europa ein friedliches Zusammenleben auf diplomatischen Wege erreichbar wäre, ist ja historisch bedingt. Die deutsche Friedensbewegung in Ost wie West hat ihre Wurzeln in den frühen 1980er Jahren.
„Schwerter zu Pflugscharen“ war ja das wirkmächtige Symbol der ostdeutschen Friedensbewegung. Aber Gauck hat auch ganz ähnliche Beobachtungen gemacht wie Rainer Eckert, was insbesondere die westdeutsche SPD und ihren Umgang mit den Bürgerbewegungen in Osteuropa betrifft. Die passten irgendwie nicht in das Konzept von „Wandel durch Annäherung“.
Immerhin ein Konzept, auf das die SPD noch heute stolz ist, denn dadurch wurde ja überhaupt erst eine Gesprächsbasis mit den Parteifunktionären im Osten geschaffen, konnten spürbare Reiseerleichterungen für die DDR-Bürger erreicht werden. Und es wurde der Weg zur Unterzeichnung der Helsinki-Akte 1975 geebnet, die auch den Bürgerrechtsbewegungen wieder Rückenwind gab – in Polen und der CSSR genauso wie in der DDR. Aber das Konzept hat sich überlebt, man kann nicht mehr so tun, als würde es heute noch Sinn ergeben.
Wer rechnete mit den Bürgern?
Das Problem war eben auch – und das analysiert Gauck sehr genau -, dass auch die Ostpolitik der SPD-geführten Bundesregierung zuallererst auf die Machthaber im Osten zielte und diese sogar stabilisierte in der Hoffnung, dann würden die kommunistischen Herrscher eher bereit sein, den Menschen mehr Freiheitsrechte zu gewähren.
Gleichzeitig aber verweigerten auch die namhaften Spitzenpolitiker der SPD den direkten Kontakt mit den Oppositionsgruppen in den Ländern, die sie besuchten. Durchaus aus dem verständlichen Wunsch heraus, neue Konflikte zu vermeiden. Was letztlich ein Hauptgrund dafür war und ist, dass diese Art Entspannungspolitik schon in den 1980er Jahren an ihre Grenzen stieß.
Denn den Wandel führten nun einmal nicht die herrschenden Funktionäre herbei, stellt Gauck fest. Den Wandel haben in allen osteuropäischen Ländern die Bürger selbst erzwungen. Allen voran die Polen und in ihrem Gefolge all die Länder, die jahrzehntelang unter dem Machtdeckel Moskaus existieren mussten und jederzeit mit der Anwendung der Breshnew-Doktrin rechnen mussten.
Die wiederum nichts anderes war als der 1956 in Ungarn und 1968 in der CSSR umgesetzte, imperiale Anspruch der Sowjetunion auf die Durchsetzung ihrer Machtinteressen in den von ihr beherrschten Ländern. Ein blinder Fleck auch in der Selbstwahrnehmung vieler Ostdeutscher, die mit der „unverbrüchlichen Freundschaft zur Sowjetunion“ aufgewachsen waren.
Das Problem des russischen Imperiums
Auch Gauck musste sich erst durch einige profunde Bücher namhafter Historiker arbeiten, um zu verstehen, dass man es hier mit einem alten Problem russischer Selbstsicht zu tun hat, das auch durch den Zerfall der Sowjetunion 1990/1991 nicht aufgelöst wurde. Eine Selbstsicht, die sich bis heute in der Legende vom „Sicherheitsgürtel“ niederschlägt, auf den Russland scheinbar ein ganz natürliches Anrecht hat.
Eine Legende, die auch von deutschen Friedensaktivisten nachgebetet wird – bis hin zu der Behauptung, Länder wie die Ukraine würden doch ganz selbstverständlich zu Russland gehören und hätten gar kein eigenes Existenzrecht. Doch die Arbeiten zum Wesen und der Geschichte des russischen Imperiums mehren sich.
Sicher ist das auch ein Nachholprozess in der Wahrnehmung osteuropäischer Geschichte. Und auch da haperte es in den letzten Jahrzehnten in der deutschen Politik. „Was wir nicht gesehen haben“, hat Gauck ein ganzes Kapitel überschrieben, der dieses Buch wieder gemeinsam mit Helga Hirsch geschrieben hat, mit der er 2009 auch seine Autobiografie verfasste. Denn Russland ist eben noch lange kein Nationalstaat im modernen Sinne.
Den meisten Westeuropäern ist gar nicht bewusst, dass Russland bis heute ein Vielvölkerstaat ist und dass all die Länder, über die es seine Hegemonie auszuüben versucht, im Lauf der vergangenen 300 Jahre mehr oder weniger gewaltsam dem russischen Imperium einverleibt worden waren.
Und was Gauck so nebenbei auch anmerkt, hätten auch andere Politiker merken können: Wladimir Putin hat sich die Büsten und Bilder all der Zaren und Zarinnen in sein Empfangskabinett stellen und hängen lassen, die an der massiven Vergrößerung des russländischen Reiches und der Unterwerfung der Nachbarvölker gearbeitet haben. Oder genauer: Die das meistens mit Militärgewalt getan haben. Und all diese Völker haben das nicht vergessen – nicht die Finnen, nicht die Balten, schon gar nicht die Polen und die Ukrainer.
Abschied von Illusionen
Und Gauck lenkt den Blick eben gleichermaßen darauf, dass auch in der Ukraine genau derselbe Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmung zum Tragen kam, wie er sich auch in der DDR 1989 zeigte. Diesen Freiheitswunsch einer ganzen Nation mit eigener Sprache, eigener Kultur und dem Wunsch zur Demokratisierung und dem Anschluss an die europäische Staatengemeinschaft abzuwiegeln mit dem Verweis auf die scheinbar so legitimen „Sicherheitsinteressen“ Moskaus, das hat schon viel mit Ignoranz zu tun.
Genauso wie die bis 2022 praktizierte Hoffnung, man könne einen Wladimir Putin, der die Auflösung der Sowjetunion für die „größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts“ hält, mit Diplomatie und „Wandel durch Handel“ im Zaum halten. Jahrzehntelang hegten gerade deutsche (Außen-)Politiker ein Wunschbild des heutigen Russlands, das mit dem tatsächlichen autokratischen Russland eines Wladimir Putin nichts mehr gemein hatte.
Und statt auf all die Grenzüberschreitungen in Tschetschenien, Georgien und der Ukraine mit klaren Ansagen zu reagieren, wich man aus, ging zum Tagesgeschäft über und vergrößerte sogar noch die Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen.
Doch dieser seltsam vergessliche Pazifismus funktioniert nicht, wenn man es mit einem Staat zu tun hat, der seine Interessen rücksichtslos und mit militärischer Gewalt durchzusetzen bereit ist. Etliche Seiten widmet Gauck logischerweise der Frage, wie viel Pazifismus eigentlich noch möglich ist, wenn man es mit einem Land zu tun hat, dessen Machtelite sich niemals von der Idee des russländischen Imperiums verabschiedet hat und die Nachbarn immer wieder mit Annexionen und Militärschlägen bedroht?
Die immer wieder bekundete westeuropäische und deutsche Verhandlungsbereitschaft erscheint dem Mann an der Spitze dieses Staates nur als Schwäche.
Auch Demokratien müssen sich wehren können
Da ist es dann tatsächlich erschreckend, wenn Deutschland in so einer Situation die eigene militärische Verletzlichkeit feststellen muss, weil die eigene Armee in den vergangenen Jahren systematisch geschwächt wurde und trotz millionenteurer „Berater“ aus dem Finanzbusiness die Ausrüstung in einem geradezu desolaten Zustand ist. Muss und darf man sich eigentlich mit so einem Thema überhaupt beschäftigen, wenn man – wie Gauck – doch in tiefster Seele Pazifist ist?
Augenscheinlich muss man es sogar. Denn auch Willy Brandt als Bundeskanzler, so stellt Gauck fest, konnte mit den Machthabern im Osten nur aus einer Position der Stärke heraus verhandeln. Die Bundesrepublik gab damals 3,5 Prozent des BIP für die Bundeswehr aus. Heute schafft Deutschland nicht einmal 2 Prozent, muss aber nun feststellen, dass sich Leute wie Putin von Verhandlungsbereitschaft nicht beeindrucken lassen. Sie respektieren nur, wenn ihr Gegner selbst eine starke Verteidigung hat.
Mehrzahl für „Leute“ in diesem Sinn, denn genauso ticken auch alle anderen Autrokraten, die weltweit scheinbar immer mehr werden. Sie akzeptieren nur die Sprache der Macht – mit Gewalt nach innen und Drohung nach außen.
Die Anfälligkeit für die Autokratie
Womit man bei Gaucks zweitem großen Kapitel in diesem Buch wäre, in dem er direkt auf die Gefährdung unserer Demokratie durch Populisten, Demokratieverächter, Rassisten und Leichtgläubige eingeht. Kenntnisreich, weil er weiß, dass Menschen ganz von Natur aus veranlagt sind, sich so zu verhalten, dass am Ende das nun einmal anspruchsvolle Projekt liberale Demokratie zerstört werden kann.
Das hat bei den einen mit dem tief verankerten Wunsch zu tun, unbedingt ohne Dissens mit ihrer Umgebung in einer möglichst konfliktfreien homogenen Gruppe zu leben, eine Disposition, die Menschen eben auch bereit macht, sich unterzuordnen, anzupassen und jeder Autorität zu glauben, die ihnen genau diese „Kuschelwärme“ verspricht. Und das andere Extrem ist die „libertäre Überdehnung“, wie es Gauck nennt – der entfesselte Egoismus, der glaubt, auf Gesellschaft und einen starken Staat verzichten zu können.
Das sind dann Menschen, die nur zu gern zur Selbstermächtigung greifen und alles, bei dem sie glauben, ihre eigene absolute Freiheit würde infrage gestellt, vehement bekämpfen.
Beides, so Gauck, spielt den erstarkenden populistischen Strömungen in die Hände, die längst in allen westlichen Staaten sichtbar geworden sind. Das Ergebnis ist dann eine „Subjektivierung des Politischen“, also letztlich eine Entfesselung der Eigeninteressen und eine um sich greifende Verachtung für das Gemeinsame. Und für die Demokratie als einem konfliktreichen Projekt, das aber gerade deshalb auch den Interessen marginalisierter Gruppen Raum gibt und Akzeptanz verschafft.
Die notwendigen Grenzen der Toleranz
Logisch, dass Gauck dann auch die so wichtige Frage thematisiert, was eigentlich Toleranz ist und wo sie ihre Grenzen hat. Und warum sich auch in der Flüchtlingsdebatte zeigt, ob wir die Demokratie als gemeinsam zu bestreitendes Projekt verstehen oder doch wieder in alte autoritäre und rassistische Verhaltensmuster zurückfallen.
Was dann auch wieder die Frage der Geschichte aufwirft und wie wir unsere Geschichte überhaupt reflektieren – also zum Beispiel auch den deutschen Kolonialismus thematisieren. Wobei auch der Umgang mit Vorurteilen zu betrachten ist, die nicht immer gleich Rassismus sind, wie Gauck feststellt. Auch eine gut gemeinte Debatte wie die über den Rassismus neigt nämlich augenscheinlich zum Extremen.
Jedenfalls dann, wenn sie wieder nur Schwarz-Weiß-Denken zur Folge hat und Vorurteile schürt, statt etwas zu befördern, was eigentlich jetzt zu einer der wichtigsten Aufgaben in der deutschen Politik wird.
Denn die aktuelle Flüchtlingsdebatte mit den Narrativen aus der Klamottenkiste verstellt den Blick darauf, dass Deutschland längst zum Einwanderungsland geworden ist, dass wir uns alle jetzt also Gedanken darüber machen sollten, wie das gemeinsame Projekt Demokratie auch mit allen Unterschieden gestaltet werden kann.
Da gibt es etwas auszuhalten und auch zu akzeptieren, dass es Fremdheiten gibt und Verunsicherung. Nicht jede ausgesprochene Verunsicherung ist auch Rassismus. Wie schaffen wir es, dass nicht nur allen auch alle Grundrechte gewährt werden, sondern auch alle Menschen teilhaben an unserer Demokratie? Und gleichzeitig der Blick geschärft wird für die tatsächlichen Gefährdungen der Gesellschaft durch Fundamentalisten, Extremisten und Rassisten, die man nicht nur unter der weißen Bevölkerung findet?
Demokratie und Menschenwürde
Oder mit Gauck formuliert: „Unsere liberale Demokratie ist keine Zwangsjacke von Geboten und Verboten, die ein bestimmtes und kein anderes Verhalten diktieren. Sie ist vielmehr eine Grundlage, die Individuen und Gruppen ermöglicht, den Raum, in dem sie leben, immer wieder zu ordnen und zu kritisieren, um den selbst gesteckten Idealen der Menschenwürde und der politischen Gleichheit gerecht zu werden.“
Gerade deshalb ist die liberale Demokratie für viele Menschen in anderen Ländern so attraktiv –und Autokraten so verhasst. Das vergessen viele Leute gern, die all die Grundrechte der Demokratie genießen, aber meinen, sie müssten sich dafür nicht mehr anstrengen oder dieses ganze permanente Aushandeln könne man sich sparen, wenn man irgendeinen „starken Mann“ an die Spitze bringt.
„Es liegt an uns, ob und wie weit wir uns der Spirale von Polarisierung und Radikalisierung widersetzen“, schreibt Gauck. „Es liegt an uns, ob und wie weit wir ein von Rechtsstaatlichkeit und Toleranz geprägtes Zusammenleben in einer Gesellschaft der Verschiedenen verteidigen.“
Joachim Gauck, Helga Hirsch „Erschütterungen“, Siedler Verlag, München 2023, 24 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
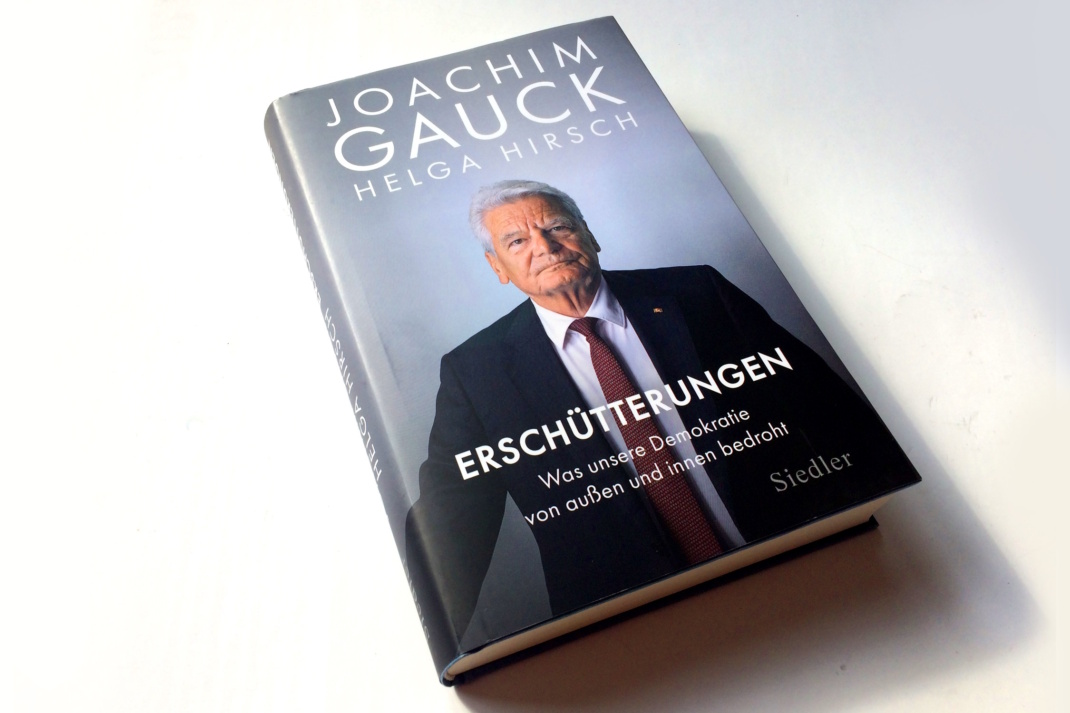



























Keine Kommentare bisher