Da stecken wir nun alle im 35. Jahr nach der deutschen Wiedervereinigung. Längst hätte zusammengewachsen sein sollen, was zusammengehört (Willy Brandt), blühende Landschaften sollten den Osten auf Augenhöhe mit dem Westen gebracht haben. Doch nichts davon ist geschehen. Stattdessen wird ein Buch Dirk Oschmanns – „Der Osten, eine westdeutsche Erfindung“ – zum Bestseller. Und Franziska Hauser und Maren Wurster fragten sich, ob es nicht an der Zeit sei, die Unterscheidung in Ost und West endlich als überholt ad acta zu legen. Ergebnis? Lauter verschiedene Antworten. Nicht nur von Frauen.
Und jede Menge Zweifel der für dieses Buch eingeladenen Autorinnen und Autoren, ob sie eigentlich etwas beizutragen hätten zu dieser nun seit Jahrzehnten anhaltenden Debatte. Auch und gerade das Thema Gleichberechtigung und Emanzipation der Frauen betreffend.
Ein Thema, das auch die beiden Herausgeberinnen aus ost- und westdeutscher Perspektive schon im „spontanen Dialog“ durchexerzieren. Immerhin stammen sie selbst aus unterschiedlichen Landeshälften, die eine aus dem Schwabenland, die andere aus Pankow. Und 1976 und 1975 geboren, haben sie einen Teil der geteilten deutschen Geschichte als Kind und Jugendliche auch miterlebt. Und sie haben da so eine Ahnung, dass auch das schon prägt. Dauerhaft. Und alle späteren Entscheidungen im Leben beeinflusst.
Kindheitsmuster
Denn wir entstehen alle nicht aus dem Nichts. Wir sind geprägt durch unsere Kindheitserfahrungen, die ausgesprochenen und unausgesprochenen Botschaften unserer Eltern. Durch das, was in unserer Umgebung als normal galt, durch Erwartungen und gesellschaftliche Zwänge, die vor 1990 in den beiden Landesteilen durchaus unterschiedlich waren. Und gerade ältere Autorinnen wissen ganz genau, dass der Vollzug der Deutschen Einheit gerade in Sachen Emanzipation auch ein Rückschritt war. Nicht nur beim Abtreibungsrecht.
Auch was die Rolle der Frau in der Berufswelt und der Gesellschaft betrifft. Denn das war schon mal anders. Im Osten. Jenem Stückchen Deutschland, das viele der jüngeren Autorinnen niemals kennengelernt haben. Und deshalb auch nicht wissen, wie sehr es gesellschaftliche Rollen verändert, wenn ein Staat sich die Gleichberechtigung der Frau tatsächlich auf die Fahne schreibt und Familien fördert und Kinderbetreuung für berufstätige Eltern selbstverständlich macht.
Ganz abgesehen von all den Gesetzen, mit denen in der DDR die Vormundschaft des Mannes über seine Frau schon frühzeitig abgeschafft wurde, genauso wie das Scheidungsrecht logischer und menschlicher gestaltet wurde und Männern das Recht auf Vergewaltigung in der Ehe abgesprochen wurde. Das vergisst man alles, wenn die DDR immer nur mit Stasi und Mangelwirtschaft in Verbindung gebracht wird.
Auch wenn die Mangelwirtschaft einer der Gründe dafür war, dass Frauen systematisch als Arbeitskräfte aktiviert werden sollten. Aber eben nicht nur in all den dienstbaren Berufen ganz unten, wo sie die Aschenputtel für die gutverdienenden Männer spielen konnten, sondern bis in die zweite Führungsebene hinauf. Ihr Wissen, ihre Kompetenz waren gefragt.
Entwertete Arbeitsleben
Dass auf der obersten Ebene dann doch wieder Männer das Sagen hatten, verstellt diese Tatsache, die einige Autorinnen in diesem Buch mit Verve ansprechen. Denn sie wissen, dass allein solche Rahmenbedingungen schon im Zwischenmenschlichen gewaltig etwas verändern. Frauen werden selbstbewusster, denn alle ihre Lebensentscheidungen hängen nicht mehr vom guten Willen ihres Mannes ab.
Und dennoch erlebten gerade die gut gebildeten, fachlich hochqualifizierten Frauen im Osten 1990, wie der patriarchalische Westen tickte – und eigentlich bis heute tickt. Sie waren die ersten, die ihre Arbeit verloren, als die große Entlassungswelle durchs Land fegte.
Eine Entlassungswelle, die sofort eine „Selbstverständlichkeit“ aus westlicher Sicht zum Dogma machte, die alles hinwegfegte, was Frauen in der DDR schon einmal geschafft hatten: dass der Mann der Ernährer der Familie ist. Und dass Familien finanziell belohnt werden, wenn der Mann ganz allein Karriere macht.
Nur dass dann nach den Frauen auch die gut qualifizierten Männer im Osten den Weg aufs Arbeitsamt antreten mussten. Millionen Berufswege auf einen Schlag entwertet. Ein ganzes Land zum Warten auf den Fluren der Arbeitsämter verdammt. Da ist nur zu verständlich, dass es da niemanden gab, der wirklich für einen echten Fortschritt in der Emanzipation im Einheitsvertrag kämpfte.
Das Thema leuchtet immer wieder am Horizont auf. Und einige Autorinnen benennen es auch deutlich als Grundlage für alle bis heute anhaltenden Missverständnisse auch im Gespräch von Ostfrau zu Westfrau. Wobei es verblüffenderweise meist die feministischen Aktivistinnen aus dem schönen, schicken Westen sind, die beleidigt reagieren, wenn ihre Gesprächspartnerinnen aus dem Osten ihnen ins Gesicht sagen, dass sie heute erst anfangen, langsam das zu verwirklichen, was für Frauen in der DDR bis 1989 normal war. Und dass all ihr kämpferischer Feminismus am Eigentlichen nie etwas geändert hat.
Freiheit und Selbstbestimmung
Dass es genau darum geht, das stellt erstaunlicherweise die im Kongo geborene Autorin Nadège Kusanika fest, die genau diese Freiheiten bei ihren Geschlechtsgenossinnen in Bayern entdeckt – und es tatsächlich als eine Freiheit interpretiert, die sich ausgerechnet Westfrauen erobert haben. Für sie ist ganz Deutschland der Westen.
Mit dem deutschen Ost-West-Schisma kann sie nichts anfangen. Aber sie sieht, welche Freiheit Frauen erobern, wenn sie über ihr Geld, ihren Familienstand und das Kinderkriegen autonom entscheiden können. Denn sie kommt aus einer noch viel konservativeren Gesellschaft, in der der Status der Frau an der Zahl der Kinder gemessen wird, die sie ihrem Mann gebärt.
Das ist so lange auch in Deutschland nicht her. Und es ist auch nie nur in Heim und am Herd ausgekämpft worden. Es geht immer um Macht. Und manchmal auch einfach um einen Staat, der Frauen rekrutieren will für eine marode Wirtschaft. Und der Familienpolitik auch macht, damit es genug Kinder gibt, die später den Laden am Laufen halten können.
Darauf geht Franziska Hauser ein, wenn sie auf die Schattenseiten der Familienpolitik in der DDR zu sprechen kommt. Denn Frauen, für die es normal war, auch in der zweiten Führungsebene (wo meist die wichtigsten Entscheidungen fallen) den Laden zu managen, lassen sich nicht so leicht mundtot machen.
„Klar waren die Frauenleben in ihren Zwängen und Freiheiten so vielschichtig wie überall“, schreibt Hauser. „Aber es hatte einen Grund, dass sich mehr Ost-Frauen in der Nachwendepolitik fanden. Sie waren die Mitbestimmung schon lange gewohnt.“
Worauf übrigens einige geradezu literarische Beiträge im Buch eingehen, die diese Frauen – Mütter, Schwestern, Großmütter – in ihrem Alltagsleben zeichnen. Thomas Brussig etwa, der geradezu liebevoll das Bild seiner Oma zeichnet, die für ihn etwas verkörperte, was die reale SED nie einlösen konnte.
Verlorene Identitäten
Aber Franziska Hauser benennt etwas, was in der ganzen West-Ost-Debatte immer wieder unter den Tisch fällt: Prägungen schaffen Identitäten. Wer diese Identitäten ignoriert, leugnet, gar abwertet, der schafft dauerhafte Kränkungen – und Missverständnisse sowieso.
„Der Verlust der eigenen Identität ist der Preis gewesen für neue Freiheiten“, schreibt Hauser. „Inzwischen darf das ehemalige DDR-Kind über das System sagen, was es will, ohne Schwierigkeiten zu bekommen oder eingesperrt zu werden. Denn es interessiert einfach niemanden mehr.“
Und das ist – wenn man genau hinschaut – noch schlimmer. Denn das bedeutet jedes Mal, wenn man so negiert wird, eben auch die Botschaft: Ihr seid nicht wichtig. Ihr gehört nicht dazu.
Und diesen Frust teilen Männer und Frauen. Auch wenn sie unterschiedlich damit umgehen. Wobei Sabine Rennefanz, die – im Osten geboren und im Westen aufgewachsen – geradezu zwischen allen Stühlen lebt, etwas anspricht, was ebenfalls fast vergessen ist: Dass es keine westdeutschen Autorinnen waren, die die wirklich beeindruckenden weiblichen Geschichten schrieben, sondern Autorinnen aus der DDR: „Ich las Bücher, Christa Wolf, Maxie Wander, Brigitte Reimann, Helga Königsdorf. Aber das waren keine Vorbilder, das waren Göttinnen, unerreichbar.“
Denn sie diskutierten auf höchstem literarischen Niveau, welchen Anspruch Frauen an ihr Leben stellen dürfen und auch sollten. Und sie sprachen damit Frauen in Ost wie West aus dem Herzen. Der Anspruch gilt. Heute immer noch.
Auch in jenem Sinn, den Rennefanz im Anschluss schildert, wenn sie erzählt, wie ihre hochqualifizierte Mutter 1990 nicht nur ihre Arbeit verlor und dann bei Aldi an der Kasse arbeiten musste, sondern auch, wie sie depressiv wurde. Auch so eine Frage, die in mehreren Beiträgen auftaucht: Kannten die Ostdeutschen keine Depressionen, egal, unter wie schäbigen Bedingungen sie arbeiten mussten? Da kommt das Bild der Härte ins Spiel.
Aber das ist nur die eine Seite. Die andere ist: Wie viel Anerkennung bekommt eine, wenn sie arbeitet? Wie viel Verantwortung darf sie tragen und wie sehr wird sie dabei respektiert?
Alte Muster
Und so taucht unverhofft das ganze ostdeutsche Dilemma doch wieder auf, das Frauen wie Männer gleichermaßen betraf: Wie schwer schlägt das aufs Gemüt, wenn einem auf einmal ohne jeglichen Respekt, regelrecht mit Verachtung begegnet wird und das eigene Leben mit allen Qualifizierungen zu Nichts abgewertet wird?
Keine Frage: Das gehört geradezu zu der längst neoliberalen Gesellschaft, die sich mit der Einverleibung des Ostens ab 1990 auch in der BRD flächendeckend entfalten konnte. Da fiel es den großen Kommentatoren der westlichen Medien leicht, all ihr Verachtung und Besserwisserei über den Osten auszukübeln. Männer durch die Bank. Die nichts so sehr verachten wie erfolgreiche und mächtige Frauen.
Und wären da nicht die Beiträge von Kerstin Hensel und Thomas Brussig, man hätte kein rechtes Gefühl für diese „,mächtigen“ Frauen, die ihre Familie zusammenhielten und zu Hause – wie man so schön sagt – „die Hosen anhatten“. Denn zur Emanzipation gehören nun einmal immer zwei.
Und wenn die Männer nicht nachziehen, sondern den Kopf einziehen, die Gefühle, den Haushalt und die Kinder den Frauen überlassen, dann entsteht das seltsame Bild, das heute immer noch oft zu beobachten ist: Männer, die fette Männerkarrieren machen, in ihrer Familie aber verstummen, Frauen die wichtigsten Entscheidungen überlassen.
Das scheint in vielen dieser Beiträge auf, in denen Frauen am Ende vor dem Dilemma stehen, dass sie die Kerle, die sie sich eigentlich wünschen, einfach nicht finden können.
Familie ist immer politisch
Und die Ansprüche sind hoch. Die ostdeutschen jungen Frauen können längst auf ihre Mütter und Großmüttergeneration als Vorbild zurückgreifen – auf deren Unterstützung sie sowieso schon immer bauen konnten. Und manchmal wundern sie sich trotzdem, dass sie sich in ihrer eigenen Lebensgestaltung dann doch irgendwie wieder wie ihre Mütter verhalten.
Obwohl das so nicht geplant war. Aber auch wenn einige Autorinnen mit dem Thema Ost/West irgendwie nicht wirklich viel anfangen können, wird deutlich, dass die ostdeutschen und westdeutschen Prägungen nicht zu übersehen sind. Dass sie das Leben der Jüngeren ebenso beeinflussen. Und niemand dem eigentlich entfliehen kann.
Wie tief die Kluft zwischen Ost- und Westfrauen war, schildert insbesondre Daniela Dahn, die – als kluge ostdeutsche Autorin, auch die Erfolglosigkeit des westlichen Feminismus registriert, der immer das Allerwichtigste ausgeklammert hat: die ökonomische Grundlage der alten patriarchalischen Ordnung, die die Ehe zum Besitzstand gemacht hat und damit alle menschlichen Beziehungen zu einem Rechtsakt gemacht hat.
Und damit eben auch Schranken definiert – „Herkunfts- und Klassenschranken“. Denn wer weiß, dass ihm oder ihr nichts geschenkt wird und dass Erfolg in einer vom Geld getriebenen (und definierten) Gesellschaft von Herkunft und Beziehungen abhängt, der hat keine Lust, gute Miene zum faulen Spiel zu machen.
Der weiß auch als Frau, dass selbst die Familie ein politischer Ort ist – und zwar nicht erst dann, wenn bekloppte Männer die „deutsche Familie“ zum Wahlkampfposter machen und damit ganz offen auf jeder Art weiblicher Selbstbestimmung herumtrampeln.
Muss man da betonen, dass einige Beiträge voller Emotionen sind? Und dass man die Wut spürt, die viele ostdeutsche Frauen zu Recht haben, die seit 1990 immer wieder „Abwärtsmobilität“ erlebt haben, wie Daniela Dahn schreibt?
Man merkt jedenfalls, dass das von Dirk Oschmann benannte Bevormundungsproblem West gegenüber Ost auch die Frauen betrifft. Vielleicht sogar besonders, weil sie nach 35 Jahren immer noch nicht wieder da sind, wo sie im Osten – was die Gleichberechtigung betrifft – schon einmal waren.
Und das ist eine politische und eine ökonomische Frage. Eine von Respekt sowieso. Aber wer erwartet von kraftprotzenden Männern Respekt gegenüber Frauen, gerade jenen, die – wie Daniela Dahn schreibt – den „höchsten Anpassungspreis für die Unvereinbarkeit von Beruf und Familie“ zahlen müssen. Sie benennt es in Bezug auf die Akademikerinnen, die den Traum von ihrem Wunschberuf mit dem Verzicht auf Kinder bezahlen müssen.
Gerade weil Kinder nicht mehr auf Wunsch der Männer „geliefert“ werden müssen und Frauen über ihre Kinderwünsche frei entscheiden können, spüren sie das Dilemma, dass sie darin trotzdem nicht frei sind. Männer auch nicht. Aber das steht dann in einem anderen Buch, das auch noch zusammenzutragen wäre. Gern mit lauter Beiträgen von Frauen. Die wissen zumindest, wo es ans Eingemachte geht.
Franziska Hauser; Maren Wurster Ost*West*frau* Frankfurter Verlagsanstalt, Frankfurt am Main 2025, 22 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
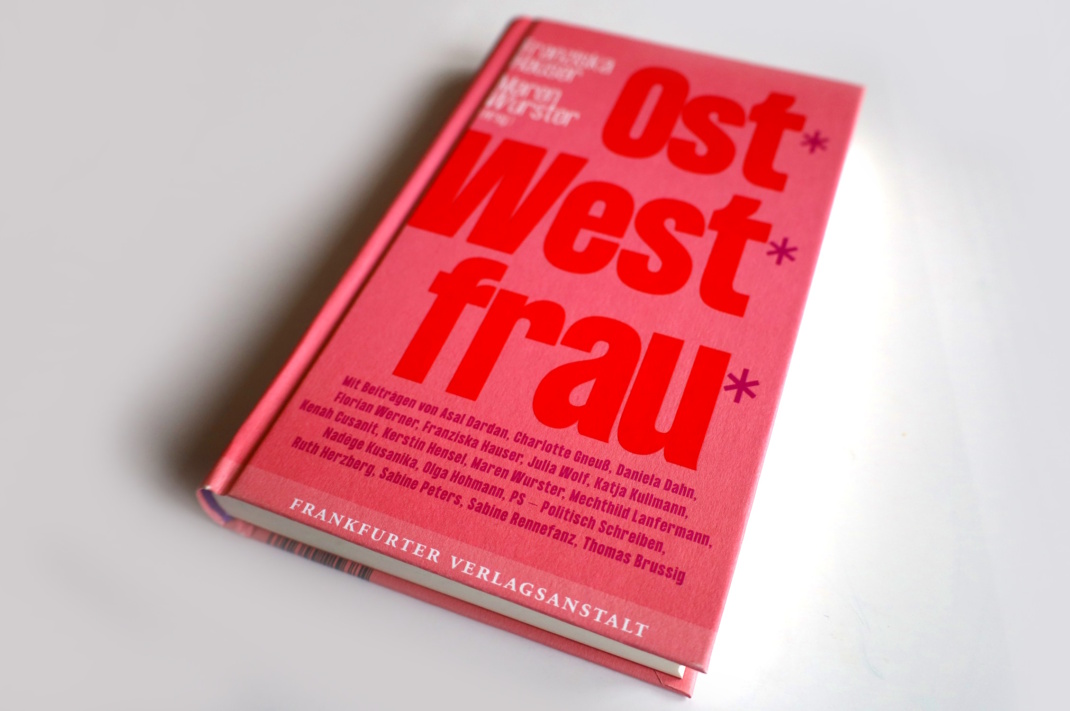


















Keine Kommentare bisher