Das war es dann wohl noch nicht. Auch wenn es 1990 so aussah, als würde nicht nur die Jahresproduktion 1990 der DDR-Verlage entsorgt werden, sondern die komplette DDR-Literatur gleich mit, dürfte die noch so manchen Leser beschäftigen und so manche Edel-Kritiker auf die Palme bringen. Selbst dieser eigenartige Johannes R. Becher, Kulturminister, Staatsdichter, Autor der Nationalhymne. Ein Autor, mit dem sich Jens-Fietje Dwars besonders intensiv beschäftigt hat.
1998 schon hat Jens-Fietje Dwars die 800 Seite dicke Becher-Biografie „Abgrund des Widerspruchs“ veröffentlicht, 2008 die „Hundert Gedichte“ Bechers im Aufbau-Verlag ausgewählt. Er kennt sich aus mit dem Werk des Mannes, mit dessen Hymnen Kinder in DDR-Schulen unliebsame Bekanntschaft gemacht haben. Kann man dessen Schriften überhaupt noch lesen?Natürlich. Gerade deshalb, weil dieser 1891 geborene Sohn eines Münchener Staatsanwalts eine derart widersprüchliche Gestalt ist und damit sogar typisch für eine ganze Reihe Schriftsteller, die in der Weimarer Republik begannen, Erfolg zu haben und am Ende im Osten landeten – Bert Brecht genauso wie Ludwig Renn, Hans Fallada oder Anna Seghers. In ihnen reißen die Widersprüche des 20. Jahrhunderts auf.
Und so, wie man in den „Buckower Elegien“ einen anderen Brecht findet als in den offiziell angepriesenen Lehrgedichten, so findet man selbst in Bechers Zeit, als er zum Kulturfunktionär der gerade gegründeten DDR wurde, Gedichte, die den Mann völlig anders zeigen – nicht mehr als überzeugten Hymnenschreiber für eine glorreich siegende Sache, sondern als Melancholiker, Trauernden, Zweifler.
Es sind 25 Gedichte, die Becher im Ostseebad Ahrenshoop geschrieben hat, seinem Zufluchtsort ab 1946, nachdem er aus dem zwölfjährigen Exil zurückgekehrt war. Hier schrieb er das Finale seines Buches „Heimkehr“ und 1948 die Notizen vom „Aufstand im Menschen“, die Dwars auch ausgiebig zitiert, weil sie genau jenen anderen Dichter zeigen, der so überhaupt nicht mit glühender Begeisterung in den Osten Deutschlands zurückkehrte, um hier an führender Stelle wirksam zu werden als Funktionär einer Gesellschaft, die – offiziell – mit der finsteren Vergangenheit brechen wollte.
Was auch Becher anders verstand als die verbissenen Genossen im Führungszirkel der SED. Den von ihm initiierten Kulturbund verstand er wirklich als Bund aller demokratisch und humanistisch denkenden Menschen. Wie tief die Kluft war zwischen dem Funktionär (der dann 1957 nach dem Schauprozess gegen Walter Janka und Wolfgang Harich physisch zusammenbrach) und dem Dichter, machen die Gedichte spürbar, die er in Ahrenshoop schrieb.
Dort, wo er in der rauen Ostseelandschaft das Spiel der Elemente beobachtete und spürte – wie er selbst schreibt – dass ihm hier die Gedichte auf einmal wie von selbst zuflogen. Als hätte er seine Rüstung abgelegt, wäre wieder fühlender und ganz von der Wucht des Lebens beeindruckter Mensch.
Manchmal verfällt er wie beiläufig in den Rilke-Ton, wird elegisch, manchmal gar schwärmerisch wie Mörike, manchmal freilich auch gedankenschwer wie Goethe oder Shakespeare. Aber davon darf man sich nicht blenden lassen, auch wenn sich dieser Klang wegliest, als wäre er fast beiläufig, als wäre das einfach nur gekonnt niedergeschriebene Naturlyrik, quasi die Ferienlyrik eines Dichters, der sich in Berlin dann wieder mit sozialistischen Hymnen quälen musste.
Aber selbst die stimmungsvollen Fotos, die Dwars seiner Auswahl beigegeben hat, verschieben den Lesefokus sehr stark auf Bechers unverhüllte Begegnung mit den Elementen, der Endlichkeit des Lebens und der beeindruckenden Schönheit der Welt. Es ist nicht nur melancholisch, was er da schreibt. Und auch nicht wirklich verzweifelt, auch wenn einige dieser Texte sehr unverblümt zeigen, wie sehr er mit seinen Genossen haderte, dass da ein Bruch war, der ihn – wenigstens als Gedicht – eine regelrechte „Absage“ schreiben ließ, einen Gruß an die „Hoffnungslosen“: „Laßt preisen euch, ihr kühnen Hoffnungslosen! / Ihr habt das Tor zum Nichtsein aufgestoßen! / O Blick ins ewige Reich der Nichtigkeit!“
Natürlich kann man sich streiten über den Adressaten. Sind damit wirklich seine Genossen in Berlin gemeint? Oder jene, die auch nach diesem Neubeginn wieder hoffnungslos sind, enttäuscht von denen, die die Macht übernommen haben und das Land zuschütten mit Parolen der Hoffnung? Vielleicht ist das die richtige Interpretation, denn Becher wusste nach seiner Zeit im Moskauer Exil nur zu genau, wie gebrochen seine engsten Kampfgefährten waren. Da könnte genau diese Zeile der Schlüssel sein: „… zu Tod getroffen / Hofft ihr noch unentwegt – wie feig gehofft!“
Dass das so abwegig nicht ist, sieht man in „Die Lichter“, wo er noch deutlicher wird: „Ihr prahlt: Wie herrlich strahlen / Scheinwerfer durch die Nacht! / Ich sage: Euer Prahlen / Hat uns kein Licht gebracht.“ Es ist eindeutig eben nicht nur das Licht auf den Wellen, das er in mehreren Gedichten benennt. So wie in dem geradezu eindeutigen Gedicht „In Licht und Finsternis“.
Denn was ist das anderes als eine Abrechnung mit seinen Genossen, die er nach dem Hotel Lux nur zu gut kannte, genau jenen Funktionären, die nun mit diesem Moskauer Hintergrund darangehen wollten, eine „neue Zeit“ aufzubauen: „Vor Ängsten nächtlich, nichtig, würdelos: / So haben wir gelebt in jenen Jahren. / Wir wuchsen auf zu einer Übermacht / Und waren machtlos, wie wir niemals waren, / Denn keine Macht half uns vor dem Verdacht. / Ein jeder war dem anderen verdächtig, / Ein jeder war des andern ungewiß. / – So hoch gestiegen und so niederträchtig!“
Zu viel hineingedeutet? Wer weiterliest, merkt: Nein. Es ist ein Gedicht über einen ganz aktuellen Schrecken. Hier geht es nicht um die Nazi-Zeit. Hier geht es um die eigenen Leute: „War unsre nicht die größte der Epochen? / Und wessen Tür wird heute Nacht erbrochen?“
Vielleicht war Becher wirklich der Einzige, der in diesem mit so einer Last gestarteten Neu-Land DDR solche Gedichte schreiben konnte, ohne dass in der Nacht die Tür zu seiner Wohnung aufgebrochen wurde.
Nur in Ahrenshoop fiel die Last von ihm ab, die Last der Loyalität, die ihn in Berlin durchhalten ließ – trotz aller Verdächtigung und Ranküne in jenem inneren SED-Zirkel, aus dem er nach und nach verdrängt wurde. Indem ihn die Genossen nach seinem frühen Tod zum größten Dichter der Nation ausgerufen hatten, war er politisch zwar heiliggesprochen, als Dichter aber völlig desavouiert. Besser konnte man den Mann gar nicht für unlesbar erklären, als ihn auf diese perfide Art zu ehren.
Und so lasen ihn auch in der DDR nur die wenigsten. Und damit sind nicht seine offiziell gewollten Texte in den Schullesebüchern gemeint. Johannes Bobrowski kannte seine Gedichte noch und würdigte ihn, weil er in ihm wirklich einen großen Dichter erkannt hatte. Christa Wolf würdigte seine Tagebuchnotizen.
Und vielleicht ist es einfach an der Zeit, ihn seiner falschen Titel und Zuschreibungen zu entkleiden, sonst sieht man den Mann nicht, der immer loyal war und dennoch wusste, dass ihm das niemand gutschreiben würde. Was ihn sogar krank machte. Und müde. „Müde“ betitelte er dann auch eins seiner kurzen Gedichte aus Ahrenshoop: „Müde bin ich alle dessen, / All der Pein, jahraus, jahrein, / Und ich will nichts als vergessen / Und will selbst vergessen sein.“
Und wer das Shakespeare-Zitat nicht überliest, sucht sich gleich Shakespeares Sonette aus dem Regal mit eben jenem zitierten Sonett, das Shakespeare in einer ganz ähnlichen Situation geschrieben hat.
Und dabei entdeckte Becher gerade in Ahrenshoop jedes Mal, dass es im Leben gar nicht um Macht, Sieg und Recht haben geht. Sondern ums Menschsein und dieses Gefühl, das man vielleicht wirklich nur stark empfindet, wenn man sich wieder allein den Elementen aussetzt. So, wie er es in „Das Einmalige“ schildert: „Daß einmal nur und nur ein einziges Mal / Mein Leben ist – ich muß es wiederholen: / Nur einmal ist mein Leben, nur einmal, / Erkennend dies, muß ich tief Atem holen …“
Aber gerade in diesem Moment kann er tiefste Dankbarkeit empfinden „für dieses herrlich-eine, einzige Mal!“ Es ist ein Gedicht, das sich in dieser Auswahl mit mehreren solcher Texte trifft, in denen Becher die Begegnung mit dem Unfassbaren in Verse zu fassen versucht, da und dort durchaus auch feierlich, ins Transzendente greifend.
Da kann er es zulassen, sich wieder gemeint zu fühlen und erkannt von einem Du, das möglicherweise Lilly Becher ist, vielleicht auch ein größeres Du. Ein Moment, in dem der Zufluchtsuchende wieder Zuflucht verspürt. Egal, wen er damit wirklich ansprach und meinte. Die Ahrenshooper Gedichte, die Dwars hier zusammengestellt hat, zeigen von diesem Becher etwas, was auch seine Zeitgenossen in der DDR eigentlich nur zu sehen bekamen, wenn sie zu Gedichten griffen, die er eben nicht für das offizielle Podium schrieb.
Aber wer den Ruf eines Nationaldichters weghat, hat es auch Jahrzehnte nach seinem Tod schwer, gelesen zu werden. Aber es lohnt sich. Gerade wenn man wissen will, wie diese Autoren aus der Frühzeit der DDR mit ihren Brüchen, Ängsten und Einsamkeiten umgingen.
Johannes R. Becher Wolkenloser Sturm, Edition Ornament, Jena 2020, 18 Euro.
Hinweis der Redaktion in eigener Sache
Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten alle Artikel der letzten Jahre auf L-IZ.de zu entdecken. Über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall.
Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.
Vielen Dank dafür.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
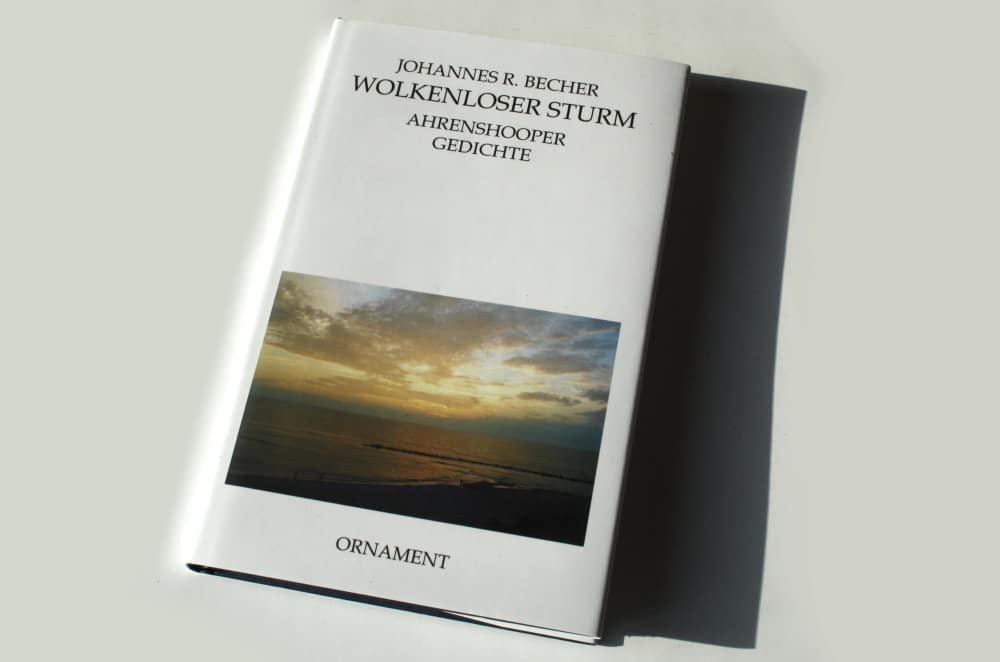



























Keine Kommentare bisher