Mit der Bibliothek „Ostsüdost“ ermöglicht der Leipziger Literaturverlag einen kleinen Blick in die Literaturen Osteuropas, darunter auch der Ukraine, die ja als Kulturland völlig zu verschwinden droht hinter den sich auftürmenden Nachrichten. Als bestünde das Land nur aus Konflikten und NATO-Interessen, und nicht aus Städten und Landschaften und lebendigen Menschen und ihren Träumen von einem erfüllten Leben.
Und auch Vasyl’ Machno erzählt davon in diesen Kurzgeschichten, die Christian Weise direkt aus dem Ukrainischen übersetzt hat. Es sind Geschichten, die hin- und herspringen über den Großen Teich, denn seit dem Jahr 2000 lebt der Schriftsteller mit seiner Familie in New York, einer Stadt, die ja geradezu davon lebt, dass Menschen hier stranden, in Landsmannschaften andocken und versuchen, irgendwie wirtschaftlich auf die Beine zu kommen.Was vielen ganz und gar nicht leichtfällt, nicht nur denen, die illegal ins Land gekommen sind und nun verzweifelt versuchen, irgendwie ihren Status zu legalisieren. Das geht auch Einwanderern aus Osteuropa so. Doch nicht allen gelingt es. Hoffnung und Scheitern liegen dicht beieinander. Und das nicht mal vor dem Hintergrund eines schönen Trugbildes eines Amerikas, das noch das Sehnsuchtsziel der Menschen wäre. Die Zeiten sind vorbei.
Machno erzählt von einem nüchternen New York, in dem die Protagonisten froh sind, überhaupt einen Job zu haben und eine leidlich bezahlbare Bude in einer der vielen Straßen, wo die Immigranten sich nach Herkunft sortieren. Da ist der Autor in gewisser Weise privilegiert. Und in einigen Geschichten scheint er selbst zu agieren. Die Übergänge sind fließend, denn seine Kurzgeschichten lesen sich zum Teil wie Aufzeichnungen, Reflexionen über das Selbsterlebte, das sich erst in der Rückschau zu einer abgeschlossenen Geschichte verdichtet.
Das ist auch bei den Geschichten nicht anders, die in Čortkiv handeln, der ukrainischen Stadt, in der Machno 1964 geboren wurde. Sie gehörte bis 1939 zu Polen und lag deshalb an der polnischen Ostgrenze, als die deutsche Wehrmacht Polen überfiel. Und es überrascht nicht, dass Machno mehrere völlig verschiedene Čortkivs zeigt, denn mit den Kriegen und Vertreibungen veränderte sich diese Stadt.
Und wie tragisch diese Geschichte war, erzählt Machno völlig ohne Pathos, aber mit sehr viel Aufmerksamkeit auf das immer schon mühselige Leben der Menschen, die alle immer damit beschäftigt sind, ihr Leben zu sichern, eine Familie zu gründen, die Kinder gut zu versorgen, egal, welcher Nationalität sie angehören.
Und bevor die jeweiligen Mächtigen beginnen, den Hass auf einzelne Bevölkerungsgruppen zu schüren, kommen sie alle in der Regel gut miteinander zurecht, haben zwar ihre Vorurteile, arrangieren sich aber und helfen einander auch in der Not. Ja, bis die Armeen, die Erschießungskommandos und Geheimdienste kommen.
Was auch in Čortkiv dazu führte, dass die Menschen, die nach dem Krieg dort lebten, nicht einmal eine Erinnerung an jene hatten, die bis zum Einmarsch der sowjetischen Armee dort lebten. Und die Kapitel aus dem von Tristesse geprägten sowjetischen Zeitalter unterscheiden sich von den von Trauer geprägten Erinnerungen aus den jüngeren Jahren der ukrainischen Selbstständigkeit.
Mit aufmerksamer Kamera begleitet Machno seine Heldinnen durch ihr Leben, blendet manchmal in Seitenszenen, verändert die Perspektive oder springt sogar ganz unverhofft in scheinbar völlig andere Geschichten, die sich aber am Ende als Teil der eigentlichen Geschichte entpuppen. Eine sehr suggestive Erzählweise, die die alte, im Grunde künstliche Vorstellung von einer in sich geschlossenen Kurzgeschichte aufbrechen. Denn natürlich spielt das Leben so nicht.
Das wünschen sich Menschen zwar, weil ein Leben dadurch erklärbar und übersichtlich wird. Aber jeder weiß es aus eigener Erfahrung, dass es oft Ereignisse sind, die anderswo ausgelöst wurden, die tief ins eigene Leben eingreifen, den Handlungsstrang verwirren oder gar abreißen lassen, Träume scheitern lassen, Hoffnungen unter sich begraben.
Dazu braucht es keinen Krieg und keine Mordkommandos. Auch wenn sie ganz unübersehbar zur Geschichte Čortkivs gehören und nicht nur die bedrohten Juden noch in den 1920er Jahren intensiv an Auswanderung denken lassen, auch wenn sie für manchen von ihnen scheitert an der bürokratischen Willkür in der Botschaft.
Auch nach dem Zweiten Weltkrieg gingen viele Ukrainer lieber ins Exil nach Westeuropa oder in die USA. Sodass sich in New York auch die verschiedenen Generationen der Auswanderer begegnen, aber vergeblich nach einem gemeinsamen Čortkiv und gemeinsamen Bekanntschaften dort in der Erinnerung suchen. Sie bleiben mehr oder weniger einsam. Mit ihnen verschwinden die Erinnerungen und auch die Erinnerungsstücke.
Schon die Kinder können mit all dem nichts mehr anfangen. Sie sind viel zu beschäftigt, sich in ihrer neuen Heimat zu behaupten. Von Assimilieren kann ja sichtlich keine Rede sein. Auch in diesem von Einwanderern geprägten New York sind die Chancen ungleich verteilt. Und nicht einmal die Flucht in das Haus auf den Klippen von Baiting Hollow hilft wirklich, wie man lesen kann. Eine Partnerschaft scheitert. Und auch der Blick auf das jeden Tag anders gefärbte Meer bietet keine Erklärung.
Man wird das Gefühl nicht los, dass unter all diesen Geschichten im Grunde eine Entwurzelung zu finden ist, die Ratlosigkeit ganzer Generationen, die ihre Ursprünge verloren haben und jetzt in zwei Welten vergeblich versuchen, das Verlorene wiederzufinden. Wobei man diese Traurigkeit ja auch in vielen anderen Romanen und Geschichten osteuropäischer Autor/-innen findet.
Es ist ja kein Land verschont geblieben, als die Tragödien des 20. Jahrhunderts über den Osten Europas hinzogen, angepeitscht von unerbittlichen Ideologien und Kriegsstiftern, die aus diesen multikulturellen Landschaften etwas machen wollten, was als gnadenlose Idee die Nationalisten in ganz Europa betrunken machte. Damit aber radierten sie in blutigen Feldzügen und Verfolgungen nicht nur uralte Kulturlandschaften aus, sondern auch die Erinnerung der Menschen.
Die erinnerte Geschichte schrumpft auf das eigene kleine Leben zusammen, den tristen Moment am Busbahnhof, wo jeder seiner stupiden Tätigkeit nachgeht, ohne dass sich das kleine, freudlose Leben in eine größere Erzählung einfügt.
Das macht Menschen klein und wurzellos. Und auch wertlos. Immer wieder reißen Machnos Lebens-Geschichten ab, stellt er fast protokollarisch am Ende nur noch fest, auf welche Weise die Menschen, deren Leben er eben noch einfühlsam begleitete, zu Tode kamen, verschwanden, sich eigentlich auflösten. Denn wenn niemand mehr da ist, der ihre Familiengeschichte weitererzählen kann, verschwinden Menschen tatsächlich einfach. Länder und Orte verlieren ihr Gedächtnis.
Was einer der Gründe mehr ist, der die Nachkommenden dann erst recht rastlos macht, zu Umhergetriebenen, für die es am Ende egal ist, ob sie in Čortkiv bleiben oder vielleicht in Paris oder New York ein bisschen besser dran sind. Sie sind ja nicht einmal mit großen Träumen unterwegs, auch nicht der Autor, wenn man ihn in einigen dieser Geschichten vermuten darf, diesen intensiv beobachteten Protokollen von Aufenthalten an verschiedensten Orten.
Stellenweise erwartet man fast, dass die Kamera herumschwenkt und einen dicken Pariser Kommissar zeigt, der mit abgeklärter Nüchternheit auf alle diese Leben schaut und schon weiß, wie alles ausgeht, ohne dass er am Ausgang irgendetwas ändern kann. In dieser Beziehung ist Machno durchaus ein Verwandter von Georges Simenon, auch wenn es in seinen Geschichten keinen solchen Kommissar gibt und die Tode auch von niemandem aufgeklärt werden, weil dieses Sterben der sowieso Heimatlosen auch die Polizei nicht wirklich interessiert.
In gewisser Weise zeigen Machnos Geschichten auch unsere Welt, wie sie tatsächlich ist, und wie wir sie aus der deutlich glücklicheren europäischen Mitte nicht wahrnehmen, weil wir die Welt immer nur durch unsere Brille betrachten und selten bis nie die Perspektive wechseln.
Wer fährt denn schon ausgerechnet in die Ukraine, um dort zu erfahren, wie es sich anfühlt, am Rand von allem zu leben, nur deshalb des Erwähnens wert, weil das Land mal wieder zum Spielball der Großen Mächte gemacht wurde, während sich die einfachen Leute, die Busfahrer, Bierverkäuferinnen, die Trunkenbolde und Irrsinnigen, die Dagebliebenen und die Traumlosen irgendwie versuchen einzurichten in Umständen, die sie selbst kaum verändern können.
Und dennoch ist dieses Čortkiv, in das Machno immer wieder hinüberblendet, wie ein Anker selbst in diesem von Hitze oder Schneestürmen geplagten New York, ein Ort in der Ortlosigkeit, der umso greifbarer wird, je mehr Machno ihn aus Erinnerungen und winzigen historischen Spuren herausdestilliert. Eigentlich hätte deshalb Čortkiv in den Titel des Buches gehört.
Aber wer in den so selbstsüchtigen USA würde sich für eine Kleinstadt in der Westukraine interessieren, irgendwo dort, wo die NATO zwar irgendwelche Interessen hat, aber ansonsten das große Rätselraten beginnt, ob das eigentlich noch Polen oder Rumänien ist oder schon Russland. Und so sehr unterscheidet sich ja auch der deutsche Blick auf diese Landschaften nicht vom amerikanischen.
Da helfen diese Kurzgeschichten schon eine Menge, denn sie zeigen Menschen so selbstverständlich in ihrem Geschäftigsein, wie man es auch aus den besten Kurzgeschichten us-amerikanischer Autoren kennt, die sich – etwa wie Raymond Carver – sehr wohl bewusst sind, dass eine Gesellschaft ziemlich traumlos und ziellos wird, wenn Menschen nur noch auf Arbeit, Auto und Prestige bedacht sind.
Oder eben irgendwo unten in der Hierarchie festhängen, wo es letztlich nur noch um die Miete, den Einkauf im Supermarkt und die Hoffnung geht, dass man keinen Rettungswagen bestellen muss, den man im Leben nie bezahlen kann. Ein ziemlich nüchternes Leben, in dem die Möglichkeiten, einfach mal auszubrechen, denkbar begrenzt sind.
Vasyl’ Machno Das Haus in Baiting Hollow, Leipziger Literaturverlag, Leipzig 2020, 19,95 Euro.
Hinweis der Redaktion in eigener Sache
Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten alle Artikel der letzten Jahre auf L-IZ.de zu entdecken. Über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall.
Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.
Vielen Dank dafür.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
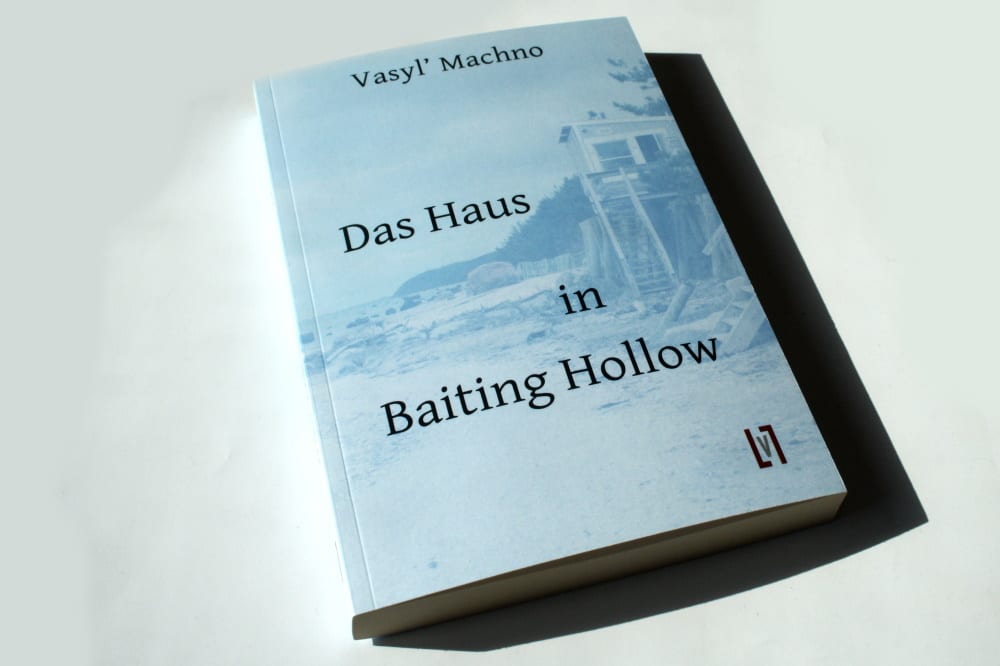
























Keine Kommentare bisher