So ein bisschen hat Andreas Köllner seinen Gedichtband unter den Schutz von Stefan Zweig gestellt, der sich am 23. Februar 1942 in Petropolis das Leben nahm. Das ist 80 Jahre her. Und natürlich war der Dichter aus Österreich in einer ganz anderen Situation „nahe jenem letzten Strand“ als der 1992 geborene Dichter aus Leipzig. Wenn man jung ist, fragt man ganz anders nach der Schwere oder Leichtigkeit der Existenz.
Verletzlichkeiten des Jungseins
Auch, wenn einem in jungen Jahren vieles ganz schwer vorkommt. Was einen später nur noch wundert. Warum hat man das so schwer genommen? Lebte man denn nicht in der unendlichen Leichtigkeit des Seins? – Aber man lebte in Unsicherheit. Denn wenn man jung ist, ist man sich selbst noch unsicher. Das eigene Selbstbild ist stets gefährdet.
Ein einziges Wort genügt: „Im Zungenschlag ein / ungesagtes Schlagwort tragend …“ Zweisamkeit bedeutet Abenteuer und Gefahr. Es kann so schnell schiefgehen. Diese verwirrenden Momente, in denen all der Liebeszauber in Scherben geht: „Du wirfst mir / Worte / an den Kopf / und triffst / mein Herz / mit deinem Schweigen.“ („Widerworte“)
Wer unterhalten ist, muss nichts aushalten
Die hohe, hymnische Form, die Stefan Zweig so gut beherrschte, ist Köllners Sache nicht. Er fängt das Leben in Miniaturen ein, so wie es viele ja auch erleben, zumindest dann, wenn sie diese Stille und Unfassbarkeit zulassen.
Was die wenigsten sich trauen. Es hat ja seine Gründe, warum wir uns all die technischen Unterhaltungsgeräte zugelegt haben. Wer stets unterhalten ist, muss nichts aushalten. Schon gar nicht die Verwirrung des Alltags. Und schon gar nicht die Stille, in der die Gedanken beginnen zu rumoren.
Wenn jeder Moment Bedeutung hat
„Wortlos bricht / der Augenblick / die ahnungsvolle Stimme“ („Aufgeblüht“). Das ist natürlich ein Nachhall der Romantik. Man merkt schon, dass Köllner auch seine Dichter der romantischen Schule gelesen hat. Das bleibt in der Regel hängen. Als Wort, als Hauch, als Gefühl. Und romantisch sind wir alle mal. Früh zumindest im Leben, wenn wir die Liebe noch ernst nehmen. Viel zu ernst.
Alles ist Bangen und Hoffen. Meist mehr Bangen als Hoffen. Denn alles ist zerbrechlich. Ein Moment der Kälte, und alles ist perdu. Natürlich geht es dann in vielen dieser Gedichte um Liebe. Und Geliebtwerden. Das also, was man eh nicht wirklich in Worte fassen kann. Momente, die immer schon Abschied und Verlieren in sich tragen: „eine Erinnerung an / dein Lächeln: / Frühlingsanfang“. („Tauwetter“)
Aber das Schöne darin ist ja, dass in dieser Phase des Lebens alles noch Bedeutung in sich trägt. Jeder Moment kann erschüttern. Was nicht am Moment liegt, sondern an uns. Auch wenn es lauter Moment-Gedichte sind, die Köllner schreibt – Gedichte aus einem zutiefst empfundenen Augenblick heraus. Aus Momenten, bei denen andere Leute ihr Handy zücken, um das nächste Bild für Instagram festzuhalten: „Spätsommerwiesen. / So grün sind sie nicht / mehr gewesen seit / dem Abend Anfang August.“ („Vergessensnah“)
Ja, so sind ja tatsächlich die Romantiker durch die Welt gelaufen. Alles hat Bedeutung. In jedem Augenblick atmet Vergänglichkeit. Noch ist man jung. Aber erstmals macht sich so eine Ahnung breit, dass das alles nicht unendlich ist.
Die Unbeschwertheit der Kindheit ist vorbei. Zeit bekommt ein anderes Gewicht. „saitenwechsel“ beschreibt dabei auch den schnellen Wechsel der Gefühle. Selbst dann, wenn der Autor merkt, wie stark er sich selbst beim Lieben unter Leistungsdruck setzt: „Mit Leistung kannst du dir die Liebe / nie verdienen …“ („Leistungs-Anspruch“)
Suche nach Ehrlichkeit
Das kann man ernst nehmen oder den Schalk dabei mitlesen, wenn er zum Schluss kommt, es könnte rentabler sein, „wenn man sich selbst / statt zu verkaufen / lieber auch verschenkt.“
Es steckt, wie man sieht, auch sehr viel Aphoristisches in diesen Gedichten. Manche sind auch echte Aphorismen, so wie „Zu Frieden“: „weniger: kriegen / mehr: / erhalten.“
Denn manchmal steckt ja die Überraschung schon in den Worten. Selbst den ungesagten. Und vielleicht irre ich mich auch, und den Meisten geht es überhaupt nicht so. Sie kennen diese Nachdenklichkeit nicht, die einen dann zum Dichter macht – oder Schriftsteller, wie es Köllner gleich im ersten Gedicht versucht zu beschreiben: „Was ist dein Schriftstellersein / andres als es ehrlich zu meinen / mit sich und dem Selbst …“
Na gut, da merkt man dann, dass er auch Philosophie studiert hat. Manchmal ähneln sich da diese zwei Berufsstände – beide fasziniert vom Beobachten und Selbstbeobachten. Vom dringlichen Verlangen, das Wesen der Dinge zu begreifen und sich selbst zu ergründen in dieser seltsamen Verbundenheit mit der Welt. „Aus dem Schweigen / wächst das Wort – / ungebrochen lohnt / hinein in deine Stille / die Gedankenfülle …“ („unausgesprochen“)
Festhalten und Loslassen
Manche schreiben dann Gedichte und versuchen, die Gedankenfülle irgendwie zu ordnen. Und wenn es in Zeilen ist, die den verwirrenden Moment aphoristisch auf den Punkt bringen. Da bekommt man, wenn man dran bleibt und sich nicht entmutigen lässt, eine ganze schöne Sammlung exotischer Schmetterlinge.
Allesamt Produkte einer Stille, die wahrscheinlich wirklich nur noch die Dichter kennen, die – um diese Stille zu finden – auch immer wieder im den Apothekergarten spazieren und dort merken, wenn ein wild wucherndes Kräutlein verschwunden ist.
„Wir wollen / unvergessen bleiben / und vergessen dabei / noch uns selbst“, schreibt er in „Verblieben“. In dem es kurz, ganz kurz ums Festhalten und Loslassen geht. Natürlich sind das Gedichte vom Jungsein. Mancher ist es und verpasst den Moment trotzdem. Und mancher steckt drin fest und merkt, dass man gar nichts festhalten kann, dass jeder Moment immer schon der Moment danach ist.
„Auf dem Weg / zum Horizont / wirst du dir plötzlich / fremd / in deiner Haut.“ „Entbindung“ hat er dieses Gedicht genannt, das nicht ganz zufällig fast am Ende des Bändchens steht. Wie ein kleines Resümee, denn am Ende von all der jugendlichen Verwirrung am Leben steht ja zumeist die Erkenntnis, wie endlich das tatsächlich ist. Dass Herbst und dichte Nebel nicht nur symbolisch erzählen von unserem Leben.
Flaschenpost und Trost-Zeilen
Das kann man mit Trauer nehmen, auch Verzweiflung. Oder auch der verwirrenden Erkenntnis, dass man auch sich selbst immer wieder hinter sich lässt. „In der Akzeptanz / irdischer Sterblichkeit / liegt eine seltsame / Ruhe …“ („Totentanz“)
Eine gewisse Melancholie ist diesen Texten nicht abzusprechen. Und natürlich der innige Wunsch herauszubekommen, wie man jetzt mit diesem ganzen Leben, Hoffen und Verlieren umgehen kann. Denn irgendwie geht es ja die ganze Zeit um die ars vivendi, die ohne die Einsicht, dass alles vergänglich ist, nicht denkbar ist.
Aber nicht leicht zu ertragen. Am Ende jedoch macht Andreas Köllner sich selbst und seinen Lesern Mut. Denn was die nächsten Jahre bringen, weiß kein Mensch. Was eben auch bedeutet: Annehmen können wir es nur, wenn wir loslassen können. Ohne Trauer keine neue Flaschenpost, könnte man sagen.
„Hoffnung / ist wie Flaschenpost“, heißt es in „Flaschenpost“.
Man kann die Texte auch wie Selbstermunterungen lesen. Kleine Trost-Zeilen bei schlechtem Wetter, wenn einen Novembernebel oder fallende Blätter daran erinnern, dass die Zeit vergeht und wir nichts festhalten können. Schon gar nicht die Geliebten mit ihrem Eigensinn. Das Leben ist so. Und manchmal bleibt dann eben nur der „Oktoberspaziergang“. Allein natürlich durch die Straße von Leipzig, wenn einem die Blätter der Linden vor die Füße trudeln. „Linde … steht sie nicht / für Liebe -?“
Das ist dann eine aphoristische Frage. Aber im Grunde bringt es einer dieser winzigen Aphorismen auf den Punkt, den Köllner sogar extra aufs Buchcover gesetzt hat: „in worte fassen / um loszulassen“.
Gibt es auch Antworten auf Flaschenpost?
Ja, das ist ein guter Grund zum Gedichte-Aufschreiben. Auch, wenn sich dann die fortgelaufenen Geliebten darin nicht wiedererkennen werden. Aber um die geht es ja nicht. Gedichte sind zuallererst Zwie-Gespräche, Selbst-Vergewisserungen. Die Suche nach Antworten auf Fragen, die sowieso keiner beantworten kann, schon gar nicht der Lindenbaum.
Und wenn man dann in Stefan Zweigs Gedichten sucht, merkt man, dass es ihm genauso ging. Und dass das wohl immer so sein wird: dass Gedichte aus unserer Verwirrung und Verblüffung am Leben entstehen. Und dass man manchmal nur ein paar Worte hat, um so ein komisches Gefühl im Bauch zu fassen: eben „eine Erinnerung an / dein Lächeln: / Frühlingsanfang.“ („Tauwetter“)
Ob die Botschaft funktioniert, bekommt man eh erst mit, wenn sie auf die Mail geantwortet hat.
Aber meistens antworten sie nicht auf die Mail.
Auch das gehört zum Leben.
Andreas Köllner saitenwechsel, tredition, Hamburg 2022, 9,99 Euro.
Hinweis der Redaktion in eigener Sache
Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten alle Artikel der letzten Jahre auf L-IZ.de zu entdecken. Über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall.
Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.
Vielen Dank dafür.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
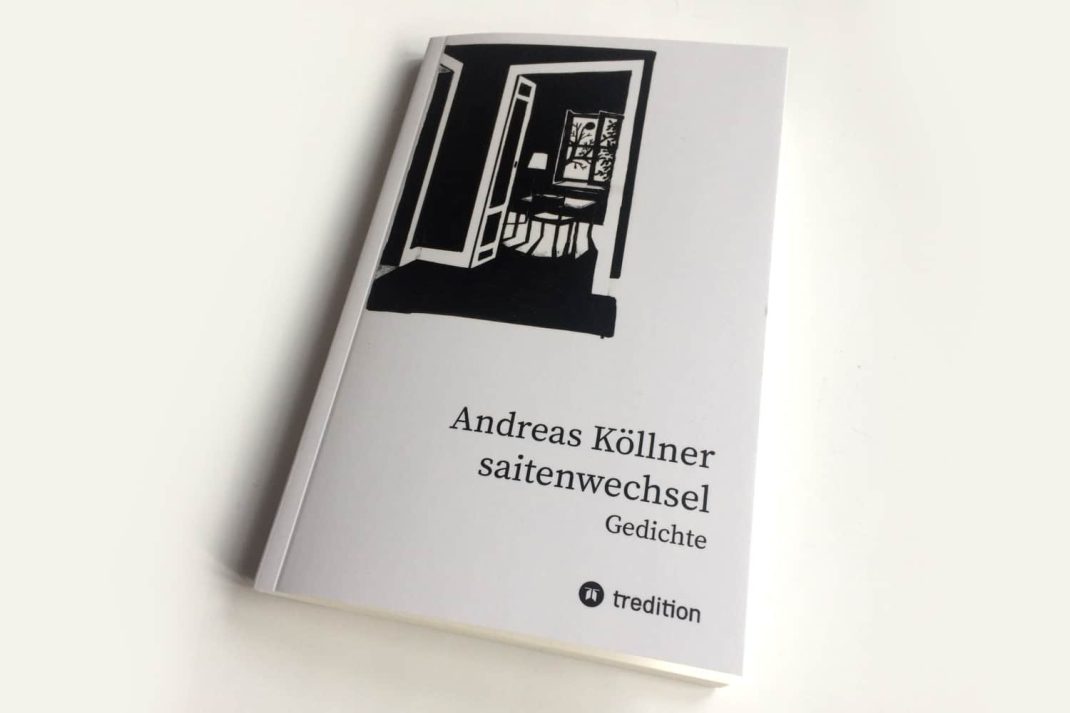






















Keine Kommentare bisher